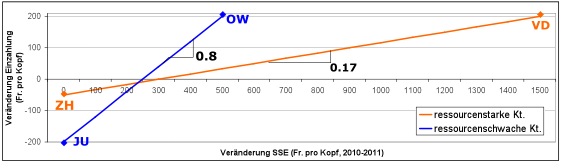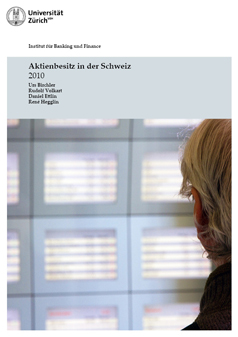In der neuesten Ausgabe der Weltwoche erreicht die Hetze gegen die Nationalbank und ihren Präsidenten Philipp Hildebrand einen neuen, für mich bisher unvorstellbaren Höhepunkt. Kurzfassung: Chefredaktor Roger Köppel möchte den Präsidenten des Direktoriums absetzen. Der Artikel geht sogar so weit, Hildebrand zu vergleichen mit Jérôme Kerviel, der wegen unrechtmässig erzielter Verluste für seine Bank Société Générale zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt wurde (in zweitletzter Instanz).
Es wäre verlockend, jetzt in den Nahkampf einzusteigen und im einzelnen zu zeigen, wie verdreht Köppels Vorwürfe allesamt sind. Sie sind es jedoch nicht wert, daher nur ein einziges Beispiel: Der Weltwoche ist es offenbar unwohl mit Ihrer Schlagzeile „La crise n’existe pas“, die sie wenige Tage vor der notwendigen Rettung der UBS durch Bund und Nationalbank publizierte. Sie will jetzt aber doch recht gehabt haben, da im Frühjahr 2010 alles schon wieder besser ausgesehen habe. Dass die Lichter in der Schweizer Wirtschaft aber nicht ausgegangen sind, liegt gerade daran, dass die Verantwortlichen bei Bund, FINMA und Nationalbank die Krise nicht geleugnet, sondern bekämpft haben. Zweimal falsch gleich richtig, rechnet die Weltwoche.
In der Schweiz darf man die Notenbank und ihre Exponenten ungestraft mit publizistischem Giftschlamm abspritzen. Die Unabhängigkeit der Presse ist ein hohes Gut. Ein ebenso hohes Gut ist die Unabhängigkeit der Nationalbank. Sonst würden nämlich Notenbankpräsidenten abgesetzt, weil sie der Politik oder der Presse nicht passen. So geschehen letztes Jahr in Argentinien, weil die Regierung kurzerhand dringend die Währungsreserven „brauchte“. Die Unabhängigkeit der Nationalbank hat uns über hundert Jahre eine Währung beschert, um die uns die Welt beneidet, und die den Grundstein unseres Finanzplatzes darstellt.
Gerade jetzt ist die Unabhängigkeit der Nationalbank besonders wichtig. Die Nationalbank hat an vorderster Front für eine Lösung des „Too big to fail“-Problems gekämpft. Nicht bei allen Bankvertretern ist dies populär. Daher die Angriffe unter allen Gürtellinien auf Präsident Hildebrand. „Er hat bewiesen, dass er es nicht kann“, zitiert die Weltwoche einen „der erfahrensten und intelligentesten Bankiers des Landes“. Anonym, selbstverständlich. Es gibt aber eine wachsende Zahl von Bankenvertretern, die verstehen, dass Staatshilfe den Finanzplatz langfristig untergräbt. Für sie wäre es höchste Zeit für ein „coming out“ — zugunsten der Unabhängigkeit der Nationalbank.