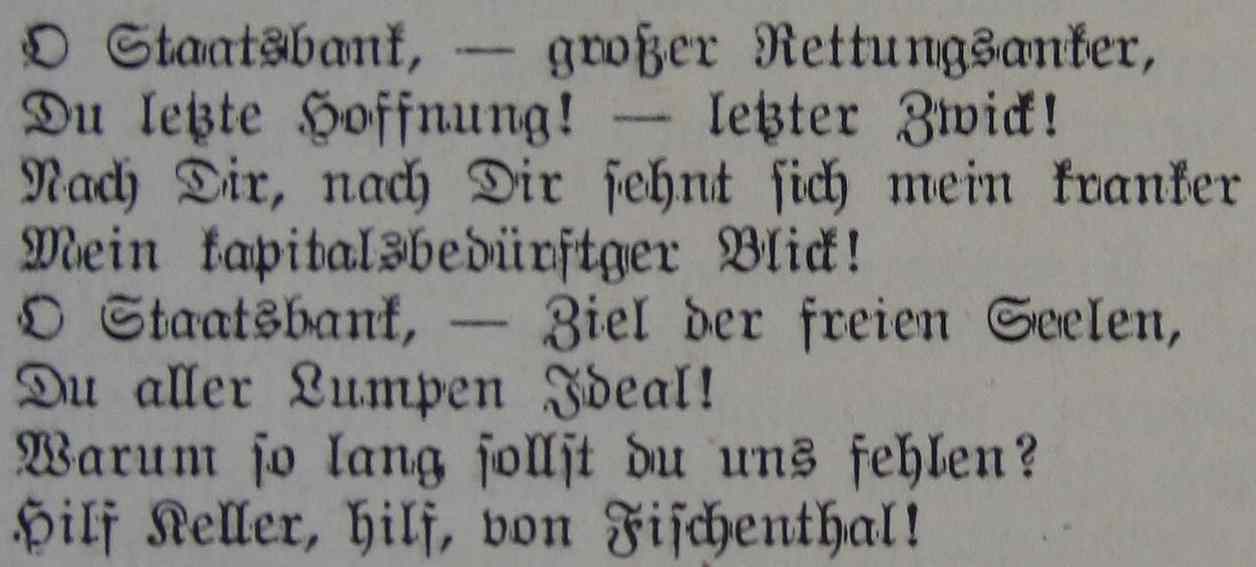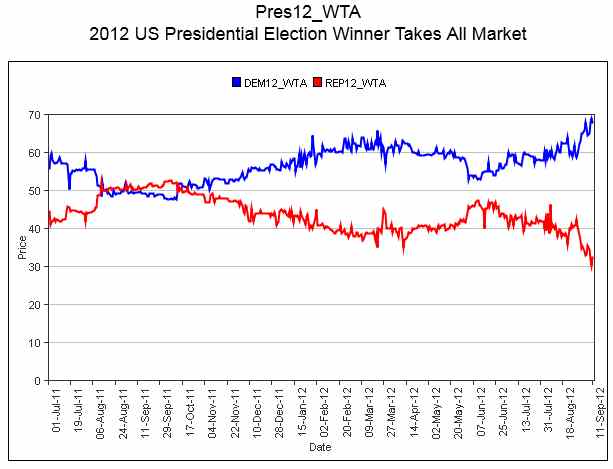Die Anfrage der Weltwoche klang harmlos. „Für einen kommenden Artikel über die Universitätslandschaft in der Schweiz suchen wir nach Portraits von Professoren. Im Falle der HSG wären das Professor Manfred Gärtner & Professor Rolf Wüstenhagen.“ Mehr dazu stand in der email Anfrage nicht. Unsere Pressestelle war besorgt.
Zu Unrecht. Was da in Philipp Guts Warnung vor Schweizer Professoren steht, ist teilweise falsch, vor allem aber belanglos und oberflächlich. Genauso harmlos wie die Anfrage eben.
Das fängt schon bei der Auswahl der Professoren an, vor denen gewarnt werden muss. Es sind die usual suspects der Weltwoche, unter anderem Andreas Fischlin (Systemökologie/Klima ETHZ), Philipp Sarasin (Geschichte UZH), Andrea Maihofer (Gender Forschung, Uni Basel), Kurt Imhof (Soziologie, UZH). Neue, nicht schon x-fach wiederholte Informationen zu diesen Personen und zu ihren furchterregenden Forschungsgebieten fanden sich im Artikel jedenfalls keine. Die Anzahl gefährlicher Professoren scheint auf jeden Fall ziemlich klein zu sein.
An der HSG lokalisierte Philipp Gut genau zwei der Professoren (Manfred Gärtner und Rolf Wüstenhagen), die schon früher in lokalen Medien politisch angegriffen wurden. So nach dem Motto: Die Wissenschaft solle sich nicht in die Politik einmischen. Wenn es Grund zur Besorgnis gegeben hätte, dann wäre es dieser Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit gewesen. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass in St.Gallen je von linker Seite gegen einzelne HSG Professoren Stimmung gemacht wurde.
Ich teile, wie andere HSG Kolleg(inn)en, längst nicht alle Meinungen von Manfred Gärtner und Rolf Wüstenhagen. Doch die Ökonomie ist keine genaue Wissenschaft und man kann – wissenschaftlich fundiert – zu unterschiedlichen Schlüssen gelangen. Letztlich ist es der wissenschaftliche Diskurs, welcher die Forschung und dadurch auch deren wirtschaftspolitische Anwendung weiterbringt. Dazu tragen meine beiden Kollegen bei – zum Glück. Wären denn der Weltwoche weltfremde Modellschreiner im Elfenbeinturm lieber?
Philipp Guts Analyse zur makroökonomischen Lehre an der HSG ist zudem nachweislich falsch. Er schreibt: „Dieses weitverbreitete Gedankengut (MB: gemeint ist der Keynesianismus) wäre auszuhalten, wenn es innerhalb der HSG ein Gegengewicht zu Gärtner gäbe. Das ist nicht der Fall“. Wie bitte? Hat Gut denn überhaupt meine anderen Kollegen und ihre Forschung angeschaut. Wer die Debatte nach der Finanzkrise auch nur halbwegs verfolgt hat, muss zum Schluss kommen, dass der Autor die letzten fünf Jahre im Tiefschlaf verbracht haben muss. Wenn der HSG von verschiedenen Seiten etwas vorgeworfen wurde, dann dass sie sich dem neoliberalen Gedankengut verpflichtet fühlte und die Finanzkrise durch die unkritische Ausbildung ihrer Studenten mitverursachte.
Zum Schluss gibt Gut noch ein bisschen Entwarnung, indem er den Studenten ein Kränzchen windet. Er schreibt: „Bildet die HSG also seit Gärtners Stellenantritt 1986 nur noch Unternehmer und Ökonomen aus, die von höheren Staatsschulden träumen und die Finanzmärkte als Problem betrachten? So schlimm steht es nicht: Unter Absolventen mit Finance-Hintergrund kursierten nach Gärtners Veröffentlichungen E-Mails mit dem Betreff: «Wer stoppt Manfred Gärtner?» „ Na also. Wenn Philipp Gut noch ein wenig mehr recherchiert hätte und ein bisschen über den Tellerrand geblickt hätte, wäre ihm eventuell etwas Entscheidendes aufgefallen: Die Forschung ist sich nämlich in einer Frage einig: Studenten lassen sich von ihren Professoren ideologisch gar nicht beeinflussen.