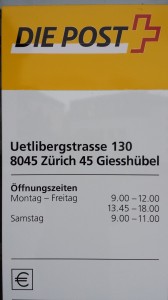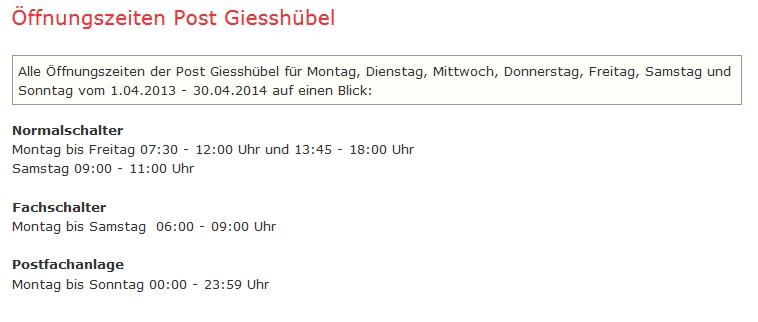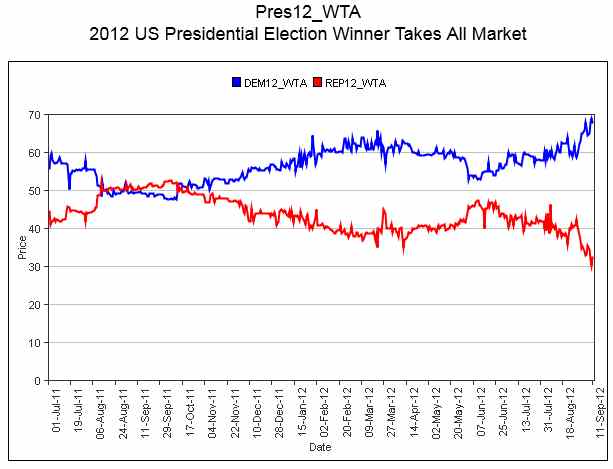Monika Bütler
Publiziert in der NZZaS vom 24. Februar unter dem Titel „Die Schulstruktur muss in jedem Fall umgebaut werden. Es braucht bessere Möglichkeiten, um Beruf und Familie zu verbinden.“
Beruf und Familie sind noch immer noch schwer zu verbinden. Die externe Kinderbetreuung ist überreguliert und sündhaft teuer; verbilligte Plätze sind rar und werden intransparent zugeteilt. Wer beim Eintritt der Kinder in den Kindergarten denkt, das Gröbste hinter sich zu haben, erwacht böse. Als wohl einziges Land der westlichen Welt kennt die Schweiz kaum Tagesschulen, die den Namen verdienen. Das Angebot besteht vielmehr aus einem grotesk zersplitterten Mix aus Schule, Hort und Mittagstisch. Unsere gestylten Schulhäuser sind zu schade, um als Verpflegungs- oder Betreuungsstätten entweiht zu werden. Dazu kommen krasse Ungerechtigkeiten: Die Urnerin, die zur Aufbesserung des kargen Bergbauernbudgets extern arbeitet, bezahlt den vollen Krippentarif (112 Franken pro Kind und Tag), die sich selbst verwirklichende, nicht arbeitstätige Zürcher Akademikerin nur einen Bruchteil.
Zeit, dass endlich etwas geschieht. Doch was?
Drehbuch A: Die Schweiz krempelt ihr Schulsystem um und geht über zu einem flächendeckenden Angebot an Tagesschulen für Kinder ab circa 4 Jahren. Blockzeiten, beispielsweise von 9–15 Uhr inklusive kurzer Mittagszeit; eine betreute (freiwillige) Aufgabenstunde am Nachmittag; je nach Schulstufe ein bis zwei freie Nachmittage um den Eltern Wahlmöglichkeiten zu bieten. Abgerundet durch eine kostenpflichtige Randstundenbetreuung (im Schulhaus!) wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu geringen Kosten stark verbessert. Damit auch Mütter mit tiefen Löhnen ihre Berufsfähigkeit erhalten können, wird das Steuersystem angepasst und durch Betreuungsgutscheine (wie in Luzern) ergänzt. Alle Vorschläge sind übrigens in der Praxis erprobt und für gut befunden.
Drehbuch B: Sogenannte Bedarfsanalysen decken Lücken bei Hort und Krippe im bestehenden System auf. Je höher der ausgewiesene Bedarf, desto mehr sorgen staatliche Ämter für angemessene Qualität: vier Quadratmeter pro Kind im Hort und am Mittagstisch – ausserhalb des Schulareals, nota bene; frisch gekochtes Essen zur Überbrückung der viel zu langen Mittagszeit; Rücksicht auf die Heterogenität der Schüler (vegetarisch, schweinefrei, laktosefrei, ponyfrei), Betreuungspersonal mit akademischem Abschluss. Selbstverständlich ist dieser Bedarf mit normalen Löhnen nicht zu finanzieren. Hinzu kommen daher einkommensabhängige Subventionen, welche dann wiederum eine mehr als symbolische Berufstätigkeit für viele Mütter zum unerschwinglichen Luxus machen.
Die hohen Kosten rufen die andere Seite auf den Plan: Mit einem gewissen Recht fordern diejenigen, die ihre Kinder selber betreuen oder sich mit Grosseltern und Kinderfrau helfen, ebenfalls Unterstützung. Schliesslich ist nicht einzusehen, weshalb die Grossmutter mit der knappen Rente nicht auch entlohnt werden soll. Am Schluss bezahlen alle sehr viel höhere Steuern, die sie teilweise in Form von Subventionen und Herd- und Hüteprämien wieder zurückerhalten. Nur: Je mehr eine Mutter arbeitet, desto schlechter der Deal.
Die Leser(-innen) die hier eine Abstimmungsempfehlung für den Familienartikel erwarten muss ich enttäuschen: Es handelt sich hier um eine vorgezogene Abstimmungsanalyse. Nicht jedes NEIN wird von hinterwäldlerischen Ewiggestrigen oder egoistischen Singles stammen. Viele Gegner fürchten, dass ein überholtes Schulsystem künstlich am Leben erhalten wird, wenn der „Bedarf“ an Betreuungsplätzen innerhalb eines nicht mehr zeitgemässen Systems gemessen wird. Umgekehrt wird nicht jedes JA von subventions-maximierenden Etatisten kommen. Viele Befürworter erhoffen sich, dass das Schulsystem endlich keine Eltern mehr daran hindert, ihre beruflichen Fähigkeiten nach eigenem Gutdünken einzusetzen.
Wie die Abstimmung auch ausgehen mag: Es ist Zeit, dass etwas geschieht. Dazu braucht es das richtige Drehbuch. Gefragt sind Ideen und Mut zur Veränderung, nicht Geld.