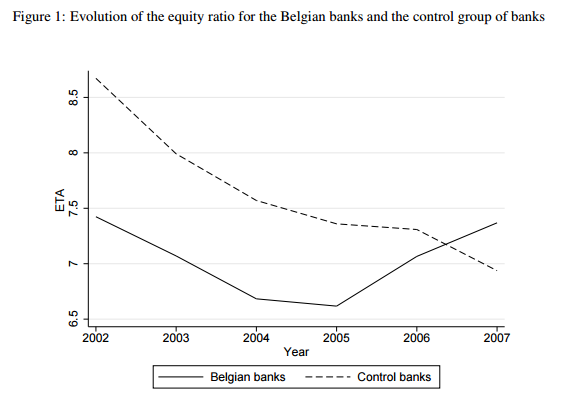Urs Birchler
Die Presse (zum Beispiel TA) berichtet dieser Tage, dass die Goldinitiative im Falle einer Annahme eine Spekulationschance auf dem Silber-, bzw. Goldtablett, serviert. Tatsächlich würde die Nationalbank zu automatischen Goldkäufen gezwungen. Wie gefährlich dies ist, illustriert ein Beispiel aus der Vergangenheit: Die Eidgenossenschaft stand wegen einer unbedacht eingegangenen Goldkauf-Pflicht 1991 am Rande des Bankrotts. Und das kam so.

Der Bund wollte sich zu seinem 700-Jahr-Jubiläum ein Geschenk machen und kam auf die Idee einer Gedenkmünze in Gold. Damit es ein richtiges Geschenk würde, beschloss er, den Nennwert auf 250 Franken festzusetzen, aber nur Gold für rund 140 Franken in die Münze zu packen — Differenz zugunsten der Staatkasse. Um die Nachfrage trotz dieser unterwertigen Prägung sicherzustellen, erklärte der Bund die Münze zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Dadurch wurde die Münze aber fast wieder zu attraktiv. Damit die Münzstätte planen konnte, musste man die Münze daher schon zwei Jahre im voraus bestellen. Im Gegenzug verpflichtete sich der Bund, alle Vorbestellungen auch tatsächlich zu honorieren.
Und damit hatte er sich selber schachmatt gesetzt. Es war ganz einfach: Wer für 250 Franken eine Münze bestellte, bekam im schlimmsten Fall ein gesetzliches Zahlungsmittel im Wert von 250 Franken. Sollte der Goldpreis aber vom Bestelldatum im April 1988 bis zur Auslieferung im Jubeljahr 1991 kräftig steigen, lag ein schöner Gewinn drin. Für den Besteller also eine risikolose Gewinnchance.
Noch schlimmer: Je höher die Bestellmenge, desto stärker würde der Goldpreis steigen und desto grösser der Gewinn für die Besteller. Die Spekulation war nicht nur risikolos, sondern auch noch selbsterfüllend: Hätten alle Marktteilnehmer ihren Gewinn zu maximieren versucht, hätte die Bestellmenge den Welt-Goldbestand überstiegen. Der Bund wäre angesichts des steigenden Goldpreises schon bei einer kleineren Menge bankrott gewesen.
Dass sich die Banken beim Bestellen edel zurückhielten, spricht für sie. Gleichwohl annullierte der Bund wenig vertragstreu die Bestellrunde mit dem Argument, sie sei „spekulativ missbraucht“ worden. Die Münze wurde ein zweites Mal ausgeschrieben; diesmal aber nur in einem teuren „Luxusetui“ aus billigem Plastic. Der Erfolg bieb deshalb mässig. Und das Etui hinterliess, sozusagen an als Erinnerung an den Vertragsbruch, auf der Münzoberfläche hässliche braune Spuren.
Trotz der dunklen Flecken kam der Bund nochmals heil davon.
Die Dummheit einer erneuten Goldverpflichtung durch Annahme der Goldinitiative könnten wir uns aber eigentlich ersparen.
[Eine detailliertere Darstellung der Münzausgabe von 1991 samt einer optionstheoretischen Bewertung findet man in meinem Beitrag in Wirtschaft und Recht von 1989. Hier zum Download]