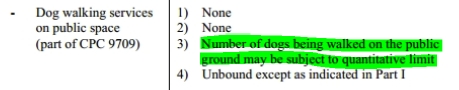Monika Bütler
(publiziert in der Handelszeitung vom 20.12.2012, unter dem etwas krassen Titel „Migration: Gefährliches Spiel im Bunkerstaat“)
Mein älterer Sohn begleitete mich letztes Jahr nach Sydney. Er besuchte dort die gleiche Schule, an der er vier Jahre zuvor eingeschult wurde. Seither erhält er regelmässig elektronische Post aus Australien: „Dear Peter, Australia needs your skills…“ In den Newsletters wird er über die neuesten Entwicklungen an der Einwanderungsfront informiert und eingeladen, sich eine Emigration ernsthaft zu überlegen. Peter ist zwar erst in der fünften Klasse, er erfüllt aber – jung und in Ausbildung – offensichtlich die wichtigsten Kriterien für ein Arbeitsvisum – im Gegensatz zu seiner Mutter, die bereits an der Altersgrenze scheitert.
Mit Peters erstem Newsletter erreichte mich eine Anfrage meiner Uni: „Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie neben der schweizerischen auch noch eine ausländische Staatsbürgerschaft besassen oder aktuell besitzen.“ Hintergrund des Schreibens: Die Internationalität der Faculty ist eine wichtige Einflussgrösse für die Platzierung einer Universität in den Rankings. Zerknirscht musste ich eingestehen, dass ich das Ranking belaste. Ich lebte zwar fünf Jahre im Ausland, aus meiner Familie stammen zahlreiche Auswanderer in die ganze Welt – sogar eine Kolumbien (Wunder) wirkende und später heiliggesprochene Nonne. Dennoch finden sich nicht einmal Spuren ausserhelvetischer Gene; sogar die Katze ist einheimisch. Meine Kinder beklagen sich schon, weil sie keinen spannenden Background haben, nun tut dies auch meine eigene Universität.
Das aktive Werben um hochqualifizierte Einwanderer wie in Australien wäre in der Schweiz unvorstellbar. Einwanderer verursachen zuerst einmal Probleme. In Australien unvorstellbar wäre hingegen, dass sich Australier für ihren Pass rechtfertigen oder sich die Kinder dafür schämen müssen. Man ist stolz, Australier(in) zu sein.
Die Situation ist paradox: Wie Australien hat die Schweiz ihren Wohlstand nicht zuletzt den unternehmerischen Einwanderern zu verdanken. Es gelingt unserem Land vorbildlich, selbst die Kinder wenig gebildeter Einwanderer zu integrieren. Nur noch Kanada hat eine höhere Erfolgsquote, dies mit Einwanderungsregeln, die Qualifizierte bevorzugen. Die Schweiz ist zudem ein äussert erfolgreiches Auswandererland; viele Spitzenköche, Hoteldirektoren, Spitzenmanager und Professoren stammen aus der Schweiz. Eigentlich müssten die Eidgenossen stolz auf diese Erfolgsgeschichte sein. Doch weit gefehlt: Die Ausländer stören, die Schweizer ebenfalls. Ein ausländischer Pass ist ein attraktives Accessoire; fürs Ranking bei den Universitäten, für die Diversity bei den Firmen, um auf dem Pausenplatz nicht als bünzlige Schweizerin zu gelten.
Passend dazu geht die öffentliche Diskussion oft völlig an der Realität vorbei. Erstes Beispiel: Wir hätten momentan eine aussergewöhnliche Masseneinwanderung, bildlich dargestellt durch eine jährlich einwandernde Stadt St. Gallen. (Warum wohl ausgerechnet St. Gallen für diesen Vergleich herhalten muss?) Dabei wanderten in den 60-er und 70-er Jahren jährlich sogar zwei St. Gallen ein. Und brachten der Schweiz nicht nur Wohlstand, sondern auch etwas Italianità und – wer wollte es heute bestreiten – besseres Essen.
Zweites Beispiel: Die Personenfreizügigkeit (PFZ) mit der EU sei die Quelle allen Übels, schuld an der Kriminalität, der Belastung der Sozialwerke, den Integrationsproblemen in den Schulen, der räumlichen Enge. Doch die widerlichen Drogenhändler im Zürcher Kreis 4, wegen der wir unsere Kinder noch immer in die Musikschule begleiten müssen, stammen offensichtlich nicht auf den PFZ Ländern. Die herumlungernden Halbwüchsigen im St. Galler Bahnhof ebenfalls nicht. Kaum einer der in der Presse präsentierten Sozialhilfebetrüger ist aus einer PFZ Region. Und die PFZ Kinder integrieren sich genau so gut wie die Schweizer Auswanderkinder im Ausland. Bei genauerem Hinsehen sind die EU Ausländer nicht einmal schuld an den hohen Mietpreisen und den überfüllten Zügen. Die Hauptreiber sind die Schweizer selber, die sich – unter tatkräftiger Mithilfe der Tiefzinspolitik – mehr Wohnraum (und wenn man böse sein wollte: mehr Scheidungen) leisten können.
Drittes Beispiel: Der Glaube, dass es uns ohne Ausländer genauso gut ginge – einfach ohne Ausländer. Es ginge uns eben kaum so gut. Und dies nicht nur wegen den Ärztinnen, Ingenieuren und Putzfrauen, die an allen Ecken und Enden fehlen. Wie bei Güterexporten bringt der Austausch von Fähigkeiten und der Wettbewerb der Talente mehr Produktivität. Wettbewerb stört zwar die Gemütlichkeit. Doch ohne Ausländer gäbe es viele der Arbeitsplätze, die uns die Ausländer angeblich streitig machen, gar nicht. Mit der Gemütlichkeit ist es schnell vorbei, wenn die Mittel dafür fehlen.
Einige Ausländer stören tatsächlich. Die schweizerische Migrations- und Asylpolitik ist nämlich genauso schräg wie die öffentliche Diskussion. Doppelt so viele Nicht-Europäer kommen zu einer Aufenthaltsbewilligung via Asyl als via reguläres Arbeitsvisum. Eines der bedeutendsten Ein- und Auswandererländer der Welt empfängt ausgerechnet die Hochqualifizierten mit der Migrationspolitik eines unattraktiven und verschlossenen Bunkerstaates. Und bestätigt dabei genau das Bild, welches den Schweizern im Ausland oft präsentiert wird und das unser Selbstbild prägt.
Höchste Zeit, selbstbewusster und optimistischer aufzutreten. Eine vernünftige Migrationspolitik sorgt dafür, dass wir nicht so werden wie es in der Anfrage der Handelszeitung für diesen Artikel so schön hiess: verwöhnt, verunsichert und international verlassen.