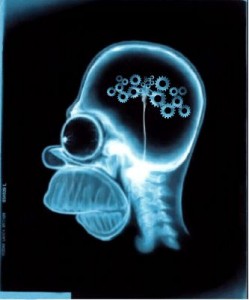Eine Universitätsausbildung ist teuer und die Finanzierung umstritten. Grossbritannien’s liberaldemokratischer Wirtschaftsminister Vince Cable schlägt eine Akademikersteuer anstelle von Studiengebühren vor. Diese Steuer würde von Universitätsabgängern ab ihrem Eintritt ins Erwerbsleben bezahlt. Spontan fällt mir da nur ein, dass es eine solche eigentlich schon gibt – die normale Einkommenssteuer. Eine Akademikersteuer verringert den Anreiz zu einer Hochschulbildung. Um die Steuer zu umgehen, könnten Absolventen auswandern („brain drain“). Das nationale Bildungsniveau wäre tiefer. Was halten Sie davon?
Archiv der Kategorie: Forschung
Zum Stand der ökonomischen Forschung und Lehre
Die Finanzkrise hat die Defizite der heutigen Forschung in Volkswirtschaftslehre und „Finance“ offengelegt. Nur wenige Ökonomen haben vor dem jetzt eingetretenen Szenario gewarnt (z.B. Raghuram Rajan oder der umstrittene Nouriel Roubini; aber auch andere unbekanntere wie Harry Makropolos, welcher im Jahr 2005 (!) der amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC geschrieben hat, dass Madoff ein Ponzi-Schema aufbaut). Dieses „Unwissen“ widerspiegelt sich im ökonomischen Curriculum, wie es an den meisten Universitäten gelehrt wird. Ein Student, der z.B. Gregory Mankiw’s Bestseller-Lehrbuch liest, versteht die Mechanismen der jetzigen Situation nicht. Natürlich braucht es Zeit, bis neuere Forschung geschrieben ist und sich in der Lehre wiederfindet, aber doch illustriert es, dass mehrere „Fault Lines“ (neues Buch von Rajan über die Finanzkrise) in der heutigen ökonomischen Forschung und Lehre existieren.
Standardisierung der ökonomischen Lehre (und Forschung?) ist ein erstes (kleineres) Problemfeld. Es wäre interessant, zu wissen, wie hoch der Marktanteil von Mankiw’s Buch ist (sehr hoch). Die meisten Programme sind heute austauschbar geworden. Ob ich z.B. in Lausanne oder in Boston studiere, es werden die gleichen Textbücher und Curricula verwendet. Das Internet fördert dies zusätzlich mittels „Plagiarismus“ – ein Dozent nimmt z.B. Übungen von einem anderen Kurs. In Bezug auf das Lernen von „technischen“ Fähigkeiten ist das eine positive Entwicklung (race-to-the-top – es werden dafür die besten Textbücher und Übungen verwendet) und auch aus Sicht von positiven Skaleneffekten erwünscht (das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden – allgemein akzeptierte Theorie muss nicht neu geschrieben werden). Ich würde auch nie soweit gehen und behaupten, dass damit ein „homo oeconomicus“ gezüchtet wird, aber die Gefahr besteht, dass Originalität und die innovative Schaffenskraft darunter leidet. Lesen Sie bitte hier weiter
Ökonomie beginnt im Kopf
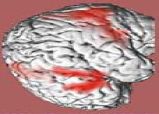 Gier, Risikoscheu, Fairness — das sind keine geheimnisvollen Ecken des menschlichen Fühlens mehr. Die Neuroökonomie bringt endlich Licht in unsere Gehirnwindungen. Wer (wie ich) diese Forschungsrichtung bis jetzt verpasst hat, hat am kommenden Freitag, 4. Juni, Gelegenheit das Versäumte nachzuholen. Prof. Ernst Fehr und sein Team eröffnen ihr Laboratory for Social and Neural Systems Research am Institut für empirische Wirtschaftsforschung in Zürich. Tag der offenen Tür im Gehirn — nicht verpassen. Prospekt und Anmeldung hier.
Gier, Risikoscheu, Fairness — das sind keine geheimnisvollen Ecken des menschlichen Fühlens mehr. Die Neuroökonomie bringt endlich Licht in unsere Gehirnwindungen. Wer (wie ich) diese Forschungsrichtung bis jetzt verpasst hat, hat am kommenden Freitag, 4. Juni, Gelegenheit das Versäumte nachzuholen. Prof. Ernst Fehr und sein Team eröffnen ihr Laboratory for Social and Neural Systems Research am Institut für empirische Wirtschaftsforschung in Zürich. Tag der offenen Tür im Gehirn — nicht verpassen. Prospekt und Anmeldung hier.
Soziologie qua Schachtelsatz
Voller guten Willens zur wissenschaftlichen Horizonterweiterung habe ich heute in einem soziologischen Werk über Ökonomie geblättert. Darin
„…wird die These vertreten, dass die Entwicklungsdynamik der modernen Ökonomie – und dies schliesst die […] evolutionären Prozesse auf den heutigen internationalen Finanzmärkten ein – sich weder durch einen Bezug auf Handlungsrationalität noch auf dem Wege einer allgemeinen Theorie materieller Reproduktion entschlüsseln lässt, sondern nur qua Analyse des Zusammenhangs ihrer rekursiv aufeinander verweisenden monetären Formen (etwa Preis, Geldfunktionen, Kapital, Profit, Zins etc.). Denn es sind diese Formen – so die zweifellos auf den ersten Blick befremdlich anmutende Überlegung –, die in der Sphäre des Ökonomischen Subjekt und Objekt vermitteln und beide Pole – das rational handelnde Individuum und die Wirtschaft als opakes Ding-an-sich – erst wechselseitig konstituieren, bzw. einer systemtheoretischen Lesart nach, die von Luhmann abstrakt konzipierte Konditionierung der Systemelemente – also Handlungen bzw. Kommunikationen – durch das System konkret bestimmen.“
So so.
Biologie und Banking
 Wie bildet sich bei der Maus eine Hand? Solche Fragen untersucht Prof. Dagmar Iber von der ETHZ, auf dem Bild mit ihren “cobis” (computational biologists) im Rahmen ihrer Forschung zu Quantitative Predictive Models of Biological Signaling Networks. Zuvor handelte Prof. Iber — mit Doktoraten in Mathematik und in Biochemie — erfolgreich Erdölderivate für eine internationale Bank. In ihrer Einführungsvorlesung vom 8. Dez. 2009 wies sie auf interessante Parallelen zwischen Modellen der Biologie und Modellen zur Bewertung von Finanzinstrumenten hin. Müssen sich Banken also mit Biologie befassen, damit ihr Risikomanagement Hand und Fuss bekommt? Oder gibt es zwischen Mäusen und Geld lediglich eine umgangssprachliche Verbindung?
Wie bildet sich bei der Maus eine Hand? Solche Fragen untersucht Prof. Dagmar Iber von der ETHZ, auf dem Bild mit ihren “cobis” (computational biologists) im Rahmen ihrer Forschung zu Quantitative Predictive Models of Biological Signaling Networks. Zuvor handelte Prof. Iber — mit Doktoraten in Mathematik und in Biochemie — erfolgreich Erdölderivate für eine internationale Bank. In ihrer Einführungsvorlesung vom 8. Dez. 2009 wies sie auf interessante Parallelen zwischen Modellen der Biologie und Modellen zur Bewertung von Finanzinstrumenten hin. Müssen sich Banken also mit Biologie befassen, damit ihr Risikomanagement Hand und Fuss bekommt? Oder gibt es zwischen Mäusen und Geld lediglich eine umgangssprachliche Verbindung?
Wo die milden Kerle wohnen
Der Urvater der Volkswirtschaftslehre, Adam Smith (1723-1790), baute seine Gesellschaftsphilosophie (Theory of Moral Sentiments, 1759) noch auf das Grundgefühl der zwischenmenschlichen Sympathie. Später kamen dem homo oeconomicus die weicheren Züge abhanden. Zurück blieb eine oft fast mechanistisch (miss-)verstandenen Rationalität. Moderne Forscher wie Prof Ernst Fehr zeigten im Labor, wie wichtig Empathie, Vertrauen und Fairness bei wirtschaftlichen Entscheidungen sind. Die gleichzeitige spektakuläre Entwicklung der Neurowissenschaften erlaubt ein vertieftes Studium dieser Faktoren durch interdisziplinären Schulterschluss verschiedener Disziplinen.
Die Universität Zürich hat heute die Gründung eines Laboratory for Social and Neural Systems Research (SNS Lab) bekanntgegeben. Das Eröffnungssymposium wird am 4. Juni 2010 stattfinden. Wir werden die Aktivitäten des SNS Lab mit Sympathie verfolgen.
Ist Glück lernbar?
 Aargauer Politiker fordern laut Bericht des Tages-Anzeiger ein Wahlfach „Glück“ an Berufs- und Oberschulen. In diesem Fach soll die „Freude am Leben“ vermittelt werden.
Aargauer Politiker fordern laut Bericht des Tages-Anzeiger ein Wahlfach „Glück“ an Berufs- und Oberschulen. In diesem Fach soll die „Freude am Leben“ vermittelt werden.
Bei solchen Vorschlägen suche ich stets den Rat des Experten. „Glück ist doch kein Fach, sondern ein Thema“, sagt unser Peter (8, 2. Klasse). Thema heisst in seiner Schule: Die Ägypter oder Dinosaurier, also etwas das einmalig angeboten wird (und Spass macht). Das trifft den Punkt. Als Dauerfach möchte er Glück nicht lernen.
Schade. Zwar wäre es leicht paradox, den Schulabschluss mit einer 3.0 in Glück zu vermasseln. Aber mindestens die Pisa-Testresultate in Glück hätten wir schon sehen wollen. Glückliche Lehrer als Nebeneffekt wären ebenfalls willkommen.
Als Ökonom sehe ich den Vorschlag aus dem Aargau als Glücksfall. „Glück“ ist nämlich das Trojanische Pferd, in dessen Bauch eine Sturmtruppe ökonomischer Gedanken und Konzepte nur darauf warten, auch die Berufs- und Oberschulen zu erobern. Und das Lehrbuch für den Glückskurs liegt bereits vor. Nein, ich meine nicht Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick, sondern Happiness, A Revolution in Economics von Bruno S. Frey, glücklich emeritierter Professor der Universität Zürich, und dessen früheres Buch Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-Being mit Alois Stutzer. Auf dieser Grundlage wäre das Glück ein gutes Thema; im Gegensatz zu alten Ägyptern und Dinosauriern scheinen glückliche Menschen noch nicht ganz ausgestorben.
Exzellenzförderung?
Zuerst die Diskussion um die Zahl der deutschen Professoren, dann der Vorwurf einer Vernachlässigung des eigenen Nachwuchs an schweizerischen Universitäten. Wie fast immer folgt auf einen vermuteten Misstand der Ruf nach staatlicher Initiative. Neuestens fordert eine überparteiliche Gruppe von Parlamentariern um Ruedi Noser (FDP) eine „nationale Exzellenzstrategie“. Ist der Interventionsfall hier wirklich gegeben? Meine Argumente gegen die staatliche Förderung von Genies finden sich in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche.
Peer Teuwsen in der Wochenzeitung Die Zeit vom 7. Januar („Hausgemachte Misere“) behauptet sogar, dass die Einheimischen auch deswegen zu wenig gefördert würden, weil sich die Professoren vor allem um die eigene Publikationsliste kümmerten. Dies widerspricht der Logik einer aktiven Forschertätigkeit, bei der gerade die Zusammenarbeit mit jungen Forschern so wichtig ist. Aber auch der Beobachtung: Die beste Nachwuchsförderung wird gerade von den forschungsstärksten Dozenten gemacht. Aus den produktivsten Unis kommen am meisten Nachwuchskräfte. In einem hat Teuwsen allerdings Recht: Allfällige Versorgungslücken an schweizerischem Nachwuchs wären auf den hohen Anteil nicht-forschender Dozenten der alten Garde zurückzuführen — übrigens in der Mehrzahl Schweizer.
Man soll unseren eigenen Nachwuchs nicht unterschätzen. Die jungen Frauen und Männer sind klug und informiert genug, den für sie besten Förderweg einzuschlagen. Nur führt ihr Weg nicht immer über Schweizerische Hochschulen.
Numerus Germanicus
An Schweizer Uni: Deutscher Professor stellt deutschen Assistenten ein. Zufall? Nein, vermuten wir. Unser Verdacht: Mit grosser Wahrscheinlichkeit hatte der Kollege kaum eine andere Wahl. Es ging ihm auch nicht anders als uns Schweizern. Dazu einige Zahlen zu kürzlich ausgeschriebenen Stellen:
Assistenz am Bankeninstitut (ISB) der Uni Zürich.
14 Bewerbungen; davon D: 6, CH: 2, A: 0
Nachwuchsdozenturen an der UniSG:
Wirtschaftspolitik: 343 Bewerbungen; davon D: 15, CH: 3, A: 1.
Quantitative Ökonomie: 125 Bewerbungen; davon D: 9, CH: 1, A: 0.
Kein Wunder sind ein Viertel der Mittelbau-Stellenprozente in deutscher Hand, wie die NZZ von heute berichtet. Eher ein Wunder, dass es nicht mehr sind. Wenn der Zürcher die Stelle in Bern verschmäht, kommt eben die Kollegin aus Rostock zum Zuge. Dies, obwohl sowohl Schweizer als auch deutsche Professoren zum Teil händeringend nach Schweizern suchen.
Und warum kommt der Professor aus Deutschland? Richtig:
Ausschreibung für Professur Internationale Ökonomie UniSG:
Bewerbungen: 32; davon D: 13, CH: 0 (in Worten: NULL), A: 2.
Bei aller Diskussion um die ausländischen Professoren sollte vielleicht auch einmal die andere Seite erwähnt werden: Eine grosse Anzahl von Schweizern lehrt im Ausland. Die meisten werden ebenso freundlich aufgenommen werden wie MB damals in Tilburg (NL). Ebenso freundlich sollten wir diejenigen behandeln, die mit viel Engagement und Enthusiasmus in der CH lehren und forschen — schliesslich profitieren wir mindestens ebensoviel von ihnen wie sie von uns.
Hier (auch für Schweizer Arbeitgeber) die Liste der Schweizer Ökonomen im Ausland.
Noch eine Gratulation: Stefan Bühler
Allen Unkenrufen zum Trotz: Es gibt sie noch; auch an „meiner“ Hochschule, der UniSG. Kollegen, die sich in der angewandten Wirtschaftspolitik verdient machen, obwohl sich ein solches Engagement innerhalb der Hochschulen kaum je lohnt. Einer davon ist Stefan Bühler, Förderprofessor des Schweizerischen Nationalfonds, mit Forschungsschwerpunkten Industrieökonomik, Regulierungstheorie und Wettbewerbspolitik. Auf den 1. Januar 2010 hat der Bundesrat Stefan Bühler zum Vizepräsidenten der Schweizerischen Wettbewerbskommission ernannt. Er soll als Ökonom zusätzliche Wirtschaftskompetenz in dieses Gremium bringen und seine beiden Kollegen aus der Rechtswissenschaft (Walter Stoffel, Uni Freiburg, und Vincent Martenet, Uni Lausanne) ergänzen. Stefan Bühler erwartet eine wichtige, interessante aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Es ist in der globalisierten Welt sehr viel schwieriger geworden zu beurteilen, ob und inwiefern Konzentrationen zu Wettbewerbsverzerrungen führen und wie damit umzugehen ist.
Noch eine gute Nachricht: Stefan Bühler ist Schweizer (seit Geburt). Berichte über das Aussterben der Schweizer Professor(inn)en sind also zumindest verfrüht.
Es dürfte im übrigen weltweit einmalig sein, dass eine Hochschule gleichzeitig in zwei nationalen Wettbewerbskommissionen vertreten ist. Neben Stefan Bühler in der Schweiz ist dies Simon Evenett in der Britischen Competition Commission.