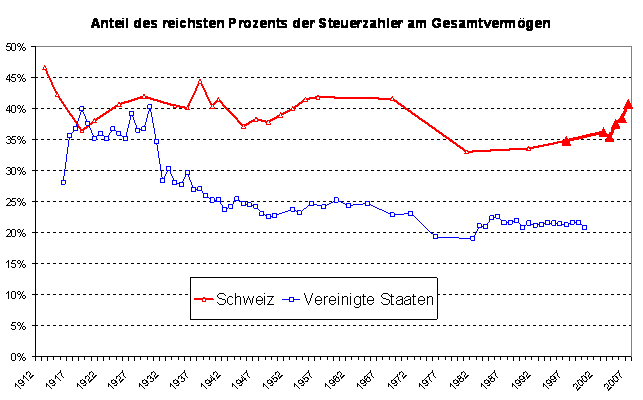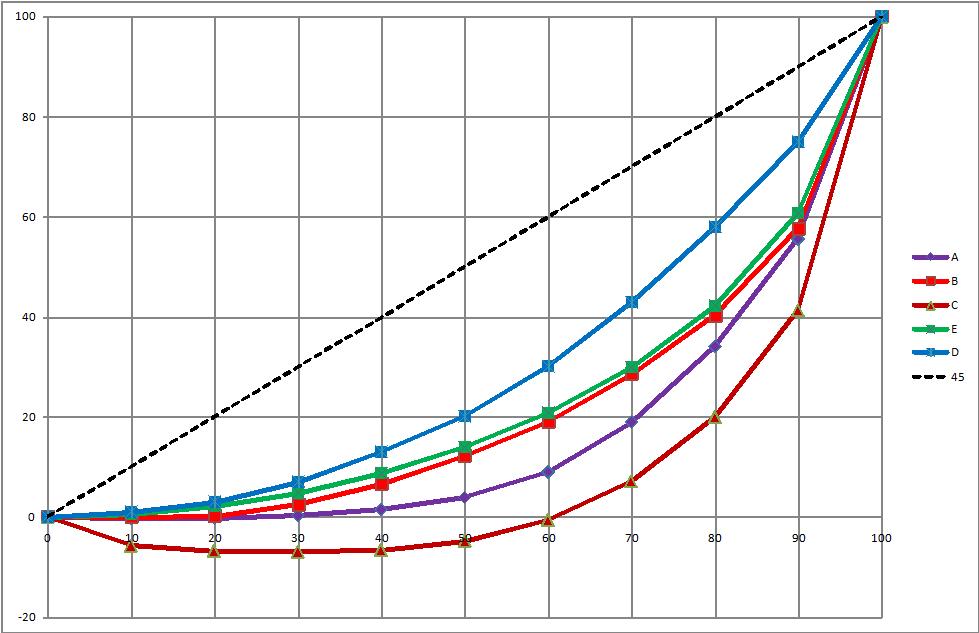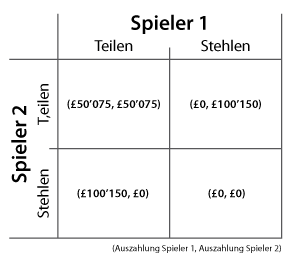In den vergangenen Tagen haben uns gleich zwei leitende internationale Gremien mit ihren Vorschlägen zur Bankenregulierung verwöhnt. Das von der G20 geschaffene FSB (Financial Stability Board) traf sich in Seoul und erliess Empfehlungen auf höchster Abstraktionsebene. Diese lesen sich wie ein Weihnachts-Wunschzettel. Mehr Kapital und Liquidität figurieren an erster Stelle. Es folgt der Wunsch nach einer Lösung der faktischen Staatsgarantie für Grossbanken (im Jargon: SIFIs, für „systemically important financial institutions“). Gefordert wird zum Beispiel eine „Capacity to resolve national and global SIFIs without disruption to the financial system and without taxpayer support“. Da auf einen richtigen Wunschzettel auch Dinge gehören, von denen man weiss, dass man sie nicht bekommen kann, folgt auch „Increasing supervisory intensity and effectiveness“. Leider sagt uns das FSF nicht, wie wir die Aufseher dazu bringen, einer Bank auf die Hühneraugen zu treten, deren Vertreter das Zehn- bis Hundertfache des Aufsehers verdienen, und die zu seinen wenigen möglichen künftigen Arbeitgebern zählt. Viel mehr als hübsches Geschenkpapier hat das FSF nicht geboten.
Der Inhalt der Päckli muss ohnehin von den nationalen Behörden und Gesetzgebern geliefert worden. Einen ersten Blick auf den Gabentisch hat die EU-Kommission mit ihrem Bericht vom 10. Oktober 2010 erlaubt. Da liegen die phantasielosen „Bessere Aufsicht“, „mehr Prävention“, die es zu jeder Weihnacht gibt, aber noch nie viel genützt haben. Dann aber schimmert durchs Papier die Aufschrift „Debt write down“. Das ist das, was wir uns sehnlichst gewünscht haben. Ohne Schuldenkürzung oder -umwandlung ist eine Insolvenz nicht zu beheben. Die ebenfalls vorhandenen Päckli „Umstrukturierung“, „Good bank — bad bank“, etc. sind nämlich unbrauchbar ohne klare Zuweisung der Verluste. Deshalb stürze ich mich auf „Debt write down“ und was finde ich? Erstens den richtigen Hinweis, dass es nicht ohne geht, und dann den ebenfalls richtigen Hinweis, dass nicht-EU-Jurisdiktionen eine Kürzung der Schulden einer EU-Bank kaum hinnehmen würden. Es folgen dann zwar genauere „Cross-Border“-Erläuterungen, aber bei der EU heisst „grezüberschreitend“ stets: innerhalb der EU.
Die Kernfrage, „Wie kürzt man Schulden, ohne das Insolvenzrecht zu bemühen und eine Rechtskrieg mit amerikanischen Behörden und Anlegern zu entfesseln?“ wird nicht weiter diskutiert, abgesehen von einer schüchtern-beiläufigen Erwähnung der Idee der „contingent convertibles“, wie sie von der Expertengruppe des Bundes vorgeschlagen wurden.
Anstatt sich mit der schwierigen, aber unvermeidlichen Frage der Schuldumwandlung auseinanderzusetzen, greift die EU-Kommission erneut zur Idee eines von den Banken zu äufnenden Stabilitätsfonds. Die hanebüchene Begründung: Die Banken, nicht die Steuerzahler, sollen für Bankenkrisen zahlen. Weshalb aber die guten Banken für die schlechten zahlen sollen, bzw. warum dies besser ist als wenn die Steuerzahler zahlen, wird nicht erklärt.
Kurz: Die EU-Kommission bietet ein Musterbeispiel an Entscheidungsschwäche und konzeptioneller Ratlosigkeit. Mangels konzeptionellem Kompass will sie von allem etwas: Mehr Kapital, mehr Liquidität, mehr Überwachung, weitergehende Kompetenzen für die Behörden, mehr Töpfe, aus denen Banken saniert werden können. Mehr Gremien, die mit vagen Aufträgen ausgestattet sind, hat sie letztes Jahr schon geschaffen. Wetten, wer inskünftig bezahlt: Steuerzahler oder Banken? Ganz einfach: Beide.