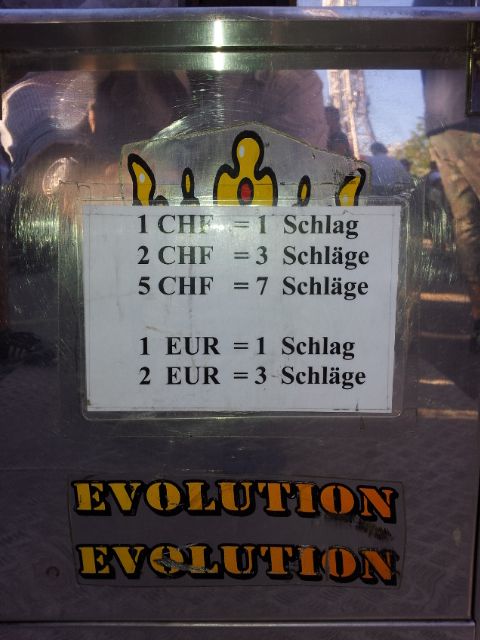In seinem Kommentar zu meinem letzten Eintrag votiert Warren@marketobservation.com für die von SP und SVP geforderte Abrennung des Investment Banking. Anstatt (wie ich) einfach höhere Eigenmittel zu fordern, schlägt er vor: Zuerst das Geschäftsmodell, dann die dazu nowendigen Eigenmittel.
Warum glaube ich nicht an die gesetzliche Trennung des Investment Banking vom „guten“ Bankgeschäft?
- Zunächst ist Investment Banking kaum praktikabel definierbar (ohne eine Reihe nützlicher Geschäftsarten zu verbieten);
- Die Einhaltung des Verbots wäre sehr schwer zu kontrollieren;
- Grosse Bankenkrisen beginnen meist nicht im Investment Banking, sondern in der guten alten Immobilienfinanzierung (siehe subprime Krise 2007). Die Regionalbankenkrise der Schweiz von 1991-94 heisst so, weil die Grossbanken die Verluste im Hypothekargeschäft durch Gewinne im Investment Banking kompensieren konnten.
- Das Investment Banking kann das Finanzsystem auch in die Krise stürzen, wenn es nicht von den Banken betrieben wird (siehe die vom Zusammenbruch der Knickerbocker Trust Co. ausgelöste Bankenkrise der USA von 1907).
- Ein derart tiefer Eingriff in die Geschäftsmodelle der Unternehmen wie ein Verbot des Investment Banking ist erst gerechtfertigt, wenn keine marktkonformeren Massnahmen (z.B. Eigenmittelanforderungen) helfen.
Vor allem brauchen wir das Investment Banking wohl nicht zu verbieten. Wenn wir von den Banken genügend hohe Eigenmittel verlangen (20-30% der Bilanzsumme), vergeht ihnen der Appetit auf sinnlose Risiken von selbst. Solange eine Bank für ihre Risiken selbst haftet, können uns ihre Verluste eigentlich auch egal sein.
In allen Punkten lasse ich mich gerne eines besseren belehren; das Thema ist zu wichtig für dogmatische Positionsbezüge. Und wer weiss: Wenn ein Händler dereinst in kurzer Zeit die halbe Bilanz verspielen kann, dann sind Eigenmittel tatsächlich für die Katz. Dann ist das Bankgeschäft aber kaum mehr in marktwirtschaftlichem Rahmen durchführbar.