Monika Bütler
Erschienen in der NZZaS, 4. Dezember 2011
Vor einigen Wochen wollte der damalige griechische Premierminister Papandreu über den Schuldenschnitt für griechische Staatsanleihen abstimmen lassen. Ebenso hätte man ber ein herannahendes Unwetter an der Urne befinden können: Das Unheil lässt sich damit nicht aufhalten. Im Gegenteil: Die Abstimmung führt höchstens zu grösseren Schäden.
Viele Schweizer belächelten die Griechen – und vergassen dabei, dass sie unlängst etwas ähnliches nicht nur planten. Sie stimmten mit grossem Ernst über den Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge ab. Eine Senkung dieses Satzes (welcher festlegt, wie viel Rente der Versicherte pro angesparten Franken erhält) ist nichts anderes als ein Schuldenschnitt, eine Reduktion künftiger Verpflichtungen der Pensionskassen. Das richtige Ausmass der Schuldenreduktion ist erst noch viel einfacher zu bestimmen als bei Staatsschulden. Es folgt direkt aus der gestiegenen Lebenserwartung und tieferen Marktzinsen. Am Schweizer Umwandlungssatz hängt nicht noch das Schicksal anderer Staaten oder gar des europäischen Bankensystems.
Was schadet schon eine rhetorische Abstimmung? Abstimmungen über Wetter oder Marktergebnisse scheinen so harmlos wie ein Plastic-Lenkrad am Kindersitz. Sie vermitteln das schöne Gefühl mitzuentscheiden, ohne zu schaden. Dies täuscht. Rhetorische Abstimmungen kosten mehr als nur den Gang zur Urne.
Jede Verzögerung einer nicht vermeidbaren Reform erhöht deren Kosten. Ein Arbeitnehmer, der erst kurz vor der Pensionierung merkt, dass die „Natur“ seinen Umwandlungssatz gesenkt hat, indem schlicht nicht mehr genug da ist, kann nicht mehr reagieren. Dazu kommt – selbst bei gleichbleibendem Kuchen – die Umverteilung der Lasten. In der schweizerischen beruflichen Vorsorge profitieren von einem zu hohen Umwandlungssatz in erster Linie gut verdienende verheiratete Männer ab 50. Die nach 1970 geborenen hingegen werden bei gleichbleibendem Umwandlungssatz vor leeren Kassen stehen.
Die Wahl des Umwandlungssatzes an der Urne und unabhängig vom Markt ist eine Illusion. Doch auch das „liberale“ Gegenstück der politisch ungestörten Marktlösung – in Form des oft gepriesenen Allheilmittels der freien Pensionskassenwahl – hat Tücken. Sie würde dazu führen, dass die Versicherungen für die Umwandlung den jeweils aktuellen Kapitalmarktsatz anwenden. Wer in Tiefzinsperioden pensioniert würde, müsste mit einer mageren Rente vorlieb nehmen. Grosse Rentenunterschiede bei fast gleich alten Rentnern haben aber mit einer optimalen Versicherung wenig zu tun. Gesucht ist daher ein Automatismus zur Anpassung für den Umwandlungssatz, der – gegeben die Lebens- und Renditeerwartungen – das langfristig Mögliche anerkennt, aber gegen die kurzfristigen Launen des Kapitalmarkts versichert.
Ein Automatismus würde zudem eine andere Form des Rentenklaus verhindern, die aus unerfindlichen Gründen kaum als solche wahrgenommen wird: die (ungleiche) Verteilung von Überschüssen. Eine Verzinsung weit unter dem Marktzins, eine eingeschränkte Freizügigkeit bei Stellenwechsel und vor allem Beitragsferien sorgten bereits in den 80er und 90er Jahren für Umverteilungen im grossen Stil. Das Aussetzen von Beiträgen (auch jener der Arbeitgeber) war nichts anderes als eine Lohnkürzung auf Zeit. Wer dank Beitragsferien 100 Franken mehr im Portemonnaie hatte, dem fehlten später mindestens 200 Franken – er zahlte also einen „Zins“ von 100%. Was anderswo als Wucher gelten würde, weckte bei den Versicherten Begeisterung.
Hoffnung besteht jedoch: Colette Nova, Mutter der Initiative „Flexibles AHV Alter für alle“ meinte noch vor gut drei Jahren „Die Behauptete Umverteilung ist eine Mär. Als Vizedirektorin beim Bundesamt für Sozialversicherung setzt sie sich heute für eine schnelle Senkung des Umwandlungssatzes ein. Zur Erinnerung: Noch im März 2010 stimmten 73% der Schweizer(innen) dagegen.

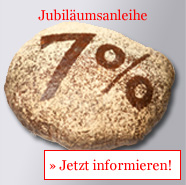 Kunden der deutschen Bäckerei-Kette
Kunden der deutschen Bäckerei-Kette