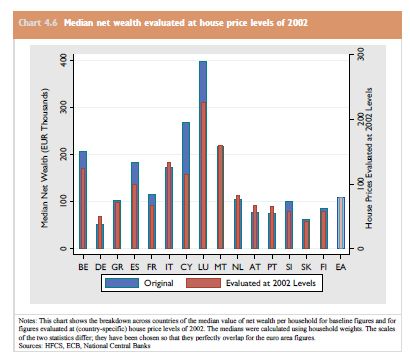Der Mieterverband ist empört. In 10 Jahren sind die Durchschnittmieten um mehr als 20% gestiegen (es sind genau 21.2%). Flugs – wie könnte es anders sein – folgt der Ruf nach staatlichen Massnahmen; eine stärkere Regulierung der Wohnungspreise, Mindestlöhne.
Doch wie hoch sind die Preissteigerungen wirklich? Immerhin sind in der Vergleichsperiode auch Preise und Löhne gestiegen. Hier also die Zahlen: Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Bevölkering stieg zwischen 2000 und 2010 um 21.5% also ziemlich genau gleich viel wie die Durchschnittsmieten. Der Anteil des Einkommens, welches für die Miete aufgewendet werden muss, blieb somit genau gleich hoch. Die Löhne stiegen tatsächlich etwas weniger stark, um 16.4%. Entscheidend für die Belastung ist allerdings das Haushalteinkommen, welches wegen der höheren Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen etwas stärker gestiegen sein dürfte als das Durchschnittseinkommen (daher auch der Vergleich mit dem BIP/Kopf).
Weitere Faktoren bleiben beim empörten Vergleich auf der Strecke: Die Grösse der Wohnungen dürfte gestiegen sein, ebenso die Qualität und Ausstattung (wer wäscht heute noch von Hand ab?).
In der Tendenz geben wir vielleicht tatsächlich einen etwas grösseren Teil unseres Einkommens fürs Wohnen aus. Doch gleichzeitig sinken die Kosten anderer Güter (Freizeit, Mobilität, Unterhaltungselektronik). Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei sinkenden relativen Kosten einen Zeitungsartikel gab.
Falls überhaupt, hätte die Klage über steigende Mietpreise 10 Jahre früher kommen sollen. Zwischen 1990 und 2000 stiegen die Durchschnittsmieten um 29%, die Löhne aber nur um 23% und das Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Bevölkerung sogar nur um 20%.