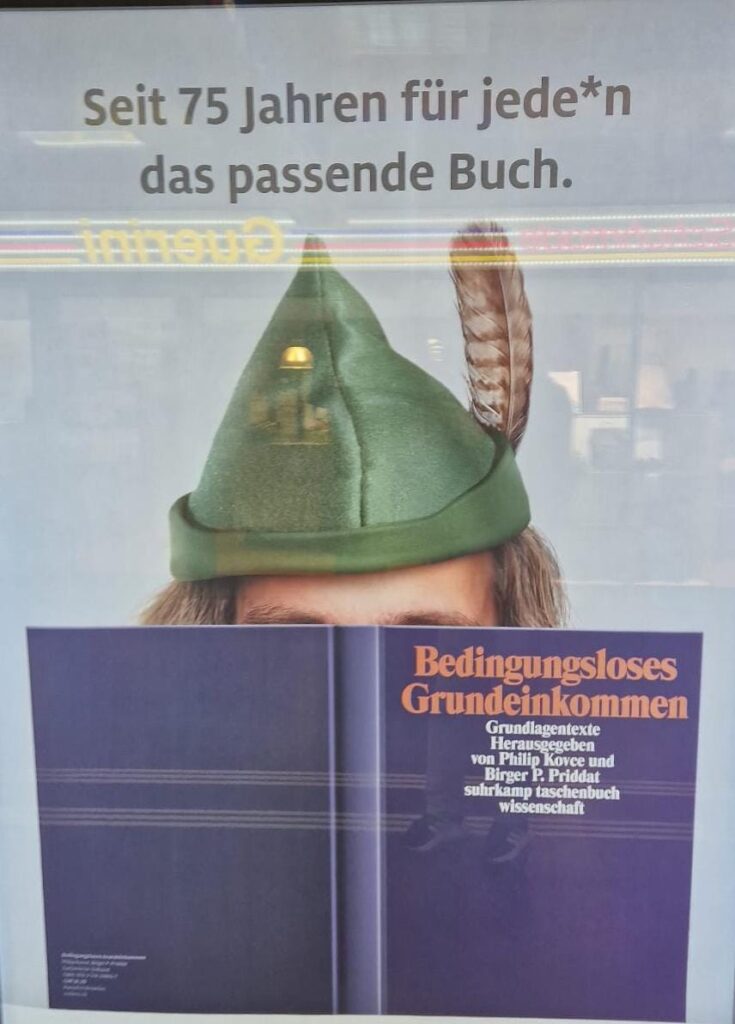Monika Bütler
Meine NZZaS Kolumne vom 19. März 2023 („Einige Staatsangestellte verdienen zu viel, andere zu wenig – und das ist ein Problem“) in etwas ausführlicherer Form
Die Stadt Zürich erhält von einem grosszügigen Gönner 500 Millionen Franken. Einzige Auflage: die Mittel müssen für jene Angestellten eingesetzt werden, die in unentbehrlichen Berufen arbeiten und am Arbeitsplatz am meisten unter Stress stehen.
Der Gemeinderat beschliesst darauf: Die wöchentliche Arbeitszeit der Angestellten mit Schichtarbeit wird während vier Jahren auf 35 Stunden reduziert – bei gleicher Entlöhnung. In den Genuss kommen Mitarbeitende in Pflege und Betreuung, in der Reinigung, bei der Stadtpolizei und den Verkehrsbetrieben. Mit der Spende werden die zusätzlich notwendigen rund 1200 Vollzeitstellen finanziert. Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet.
Den edlen Spender gibt es natürlich nicht. Alles andere jedoch entspricht genau der Realität, genauer: dem Mitte März 2023vom Zürcher Gemeinderat vorgeschlagenen Pilotversuch, eingeschlossen dessen vom Stadtrat geschätzten Kosten und der geplanten wissenschaftlichen Begleitung.
Als Gedankenexperiment hat der vorgeschlagene Pilotversuch auch ohne Gönner einen gewissen Charme. Er legt den Finger, wohl eher unbeabsichtigt, auf einen wunden Punkt. Bei den Anstellungsbedingungen öffentlicher Angestellter stimmt nämlich etwas nicht, nicht nur bei der Stadt Zürich: Das Lohngefüge im öffentlichen Dienst steht schief und dies schadet nicht nur dem Gemeinwesen, sondern auch der Gesamtwirtschaft.
Nicht erst seit der Pandemie wissen wir, dass die Belastung an der “Front”, d.h. in Bereichen wie der Pflege, der Polizei, der Müllabfuhr und den Verkehrsbetrieben hoch ist. Viel höher als bei administrativen Berufen, bei denen es – so mindestens lassen es viele Stimmen in den Medien vermuten – möglich wäre, die bisherige Leistung in weniger Zeit zu erbringen bei erst noch viel flexibleren Arbeitszeiten.
Aussagen über zu grosszügige Gehälter beim Staat sind deshalb teils verständlich, aber vor allem zu pauschal. In einigen Bereichen hat der Staat Mühe, Fachkräfte zu finden. In anderen, zum Beispiel bei gewissen Stabstellen, erhält der Bund dermassen viele Bewerbungen, dass selbst hochqualifizierte und genau aufs Profil passende Leute nicht einmal in die zweite Runde kommen.
Die einen verdienen zu wenig, die anderen zu viel – dies wäre meine lapidare Einschätzung als Ökonomin. Bei der öffentlichen Hand bestimmt hängt der Lohn tatsächlich in den allermeisten Fällen von zwei Dingen ab: von den geforderten (nicht den schwierig messbaren vorhandenen!) Kompetenzen und von der Ausbildung. Gleichzeitig berücksichtigen die Funktionsstufen der staatlichen Organisationen vieles nicht: Die unterschiedliche körperliche und psychische intensive Belastung nur am Rande, die Knappheit der verschiedenen Berufe gar nicht und den Nutzen für die Bevölkerung noch zuallerletzt.
Diese Verzerrungen haben ihren Preis. Die Angestellten in den unentbehrlichen Front-Bereichen, von der Kehrichtabfuhr bis zur Notfallaufnahme, müssen immer mehr leisten. Jene in den – sogenannt direkt produktiven – Dienstleistungsbereichen wie Betreuung oder Reinigung müssen immerhin mitansehen, wie administrative – sogenannt indirekt produktive – Berufe unter viel besseren Anstellungsbedingungen arbeiten: Der Job-Magnet Bürokratie funktioniert, weil die Verwaltung selber Stellen schaffen kann auf Kosten der Leute an der Front, die dies nicht können.
Die schiefen öffentlichen staatlichen Lohnstrukturen wirken weit über den Staat hinaus. Marktblinde Vergütungssysteme verzerren nicht nur die Studien- und Berufswahl. Zahlt der Staat „zuviel“, entweder direkt oder über eine geringere Arbeitsbelastung, fehlen dem Privatsektor die Fachkräfte. Oder sie sind zu teuer. Die internationale Konkurrenz limitiert die Löhne in den Privatfirmen stärker als die immer noch passiven privaten Steuerzahler die Löhne beim Staat. Dazu kommt noch, dass der Anteil der Steuerzahler aus der Privatwirtschaft dauernd abnimmt gegenüber jenem aus dem stark wachsenden öffentlichen Sektor.
Bei aller Kritik am vorgeschlagenen Zürcher Pilotversuch: Es ist richtig und wichtig, über die Arbeitsbedingungen von Pflege, Polizei und ähnlich gelagerten Diensten mit Schichtbetrieb zu diskutieren und Verbesserungen anzubringen. Aber welche? Hat jemand die Beschäftigten gefragt? Der Zürcher Vorschlag mit seinem Einheitsguetsli, einem höheren Stundenlohn via eine geringere Arbeitszeit, scheint reichlich paternalistisch. Vielleicht würde die eine Fachfrau Betriebsunterhalt oder der andere Flughafenpolizist lieber die ursprüngliche Arbeitszeit beibehalten, aber mehr verdienen. Oder ein bisschen von beidem.
Das Verstecken der Lohnerhöhung hinter einer verkürzten Arbeitszeit für einen Teil der Angestellten hat möglicherweise einen tieferen Grund. Der Pilotversuch riecht nach Trojanischem Pferd. Für einmal bedienen nämlich die Initianten aus linken Kreisen nicht primär die eigene Klientel – scheinbar. Dass dies nämlich kaum so bleiben wird, zeigt die Reaktion des Zürcher Finanzvorstandes Daniel Leupi: «Wir wollen auf keinen Fall den Lohnfrieden gefährden», meint er: eine 35-Stunden-Arbeitswoche nur für Angestellte im Schichtbetrieb würde das Gebot der Gleichbehandlung aller städtischen Angestellten verletzen. Als gäbe es sonst keine Ungleichbehandlungen …