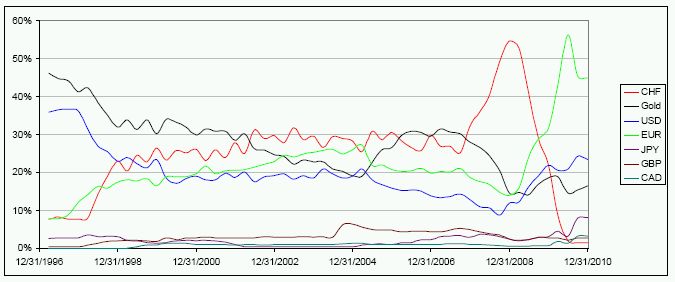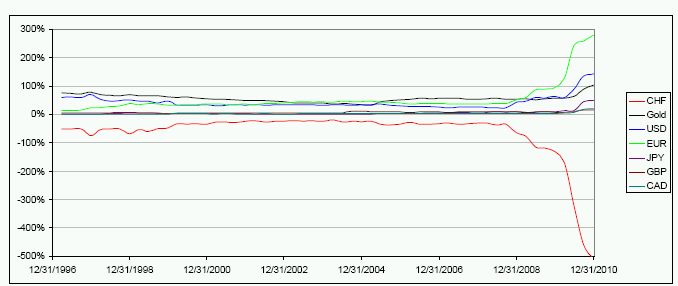„Die Nationalbank muss statt Euros kaufen Franken drucken.“ Dies schreibt der Blick in der Online-Ausgabe von heute. Stammte der Artikel nicht aus der Hand des stellvertretenden Chefredaktors, man könnte verwundert darüber hinweggehen. Drum hier nochmals: Franken drucken macht nur Sinn, wenn diese Franken auch in den Umlauf gelangen. Bis hier ist es genau wie beim Blick, von der unterschiedlichen Druckqualität einmal abgesehen. Man kann das Druckerzeugnis verschenken (Gratisanzeiger) oder verkaufen. Blick und die SNB haben sich für die letztere Variante entschieden. Den Erlös muss man dann verwenden. Die SNB — hier trennen sich die Wege — braucht nur einen winzigen Bruchteil der Erträge für Löhne etc. Den Rest muss sie anlegen. Dabei hat sie im wesentlichen die Wahl zwischen Dollar und Euro. (Gelegentlich taucht in der Diskussion noch die Forderung auf: „Die Nationalbank muss inländische Obligationen oder Aktie kaufen, damit das Geld der inländischen Wirtschaft zugute kommt.“ Aber investieren Sie doch mal innerhalb von einigen Tagen ein paar Milliarden Franken in die Schweizer Wirtschaft, und zwar so, dass sich niemand benachteiligt vorkommt, und so, dass die Anlagen auch rasch wieder verkauft werden können.) Franken drucken ist also gleichbedeutend mit Euro (oder Dollars) kaufen.
Bedenklich ist, dass der stv. Chefredaktor der auflagenstärksten Schweizer Tageszeitung den Quatsch noch abgeschrieben hat. Die Devise „Franken drucken statt Euro kaufen“ wurde von Peter Bodenmann in Umlauf gesetzt. Hätte der Blick batz.ch gelesen, wo wir bereits protestiert haben (Eintrag vom 30. Juni), wär’s nicht passiert. Batz war dabei.