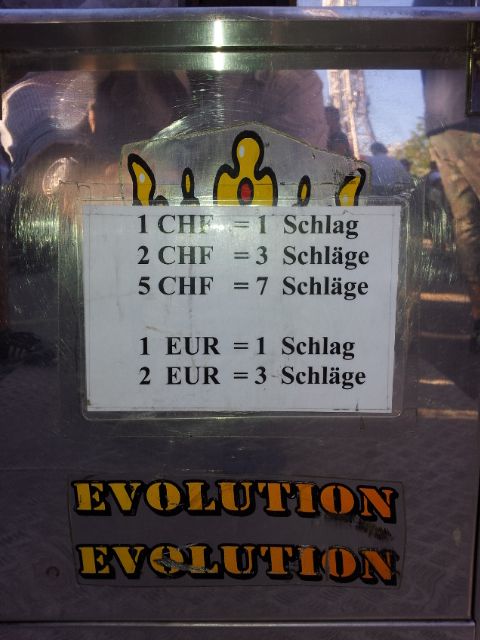Aleksander Berentsen
Anmerkung: Der folgende Artikel erschien am 11. Oktober in der Basler Zeitung.
Heute habe ich die Ehre, den ersten Preis für die unsinnigste Initiative des Jahrzehnts zu vergeben. Sie geht an die sogenannte „Ravioli-Initiative“.
Vielleicht werden Sie sich fragen, wie man einen solchen Preis bereits im ersten Jahr des neuen Jahrzehnts vergeben kann? Nun, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in den kommenden Neun Jahren eine Initiative lanciert wird, welche die „Ravioli-Initiative“ vom Thron stossen könnte.
Sie haben vielleicht schon erraten, wovon die Rede ist. Von der Initiative „Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)“, welche im September 2011 von verschiedenen SVP-Exponenten lanciert wurde. Was hat diese Initiative mit Ravioli zu tun? Der Grund liegt in den Forderungen, die von der Initiative aufgestellt werden. Diese lauten wie folgt:
Erstens, die Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sind unverkäuflich.
Zweitens, die Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sind in der Schweiz zu lagern.
Drittens, die Schweizerische Nationalbank hat ihre Aktiven zu einem wesentlichen Teil in Gold zu halten. Der Goldanteil darf zwanzig Prozent nicht unterschreiten.
Die Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sollen also unverkäuflich werden. Lassen sie mich in Alltagssprache übersetzen, was diese Forderung bedeutet. Als Vorstand Ihres Haushalts beschliessen Sie, einen Notvorrat an speziellen, nie verderbenden Ravioli anzulegen. Sie tun das, weil sie nicht naiv sind und wissen, dass auf gute Zeiten auch schlechte folgen können. Ein Vorrat an Ravioli (und Mineralwasser) wird Ihnen im schlimmsten Fall das Überleben für ein paar Wochen garantieren.
Im Verlauf der Zeit entdecken Sie, dass Sie ab und zu eine Ravioli-Büchse öffnen und essen, obwohl keine Not besteht. Sie waren vielleicht einfach zu faul zum einkaufen oder die Zeiten waren derart lange so gut, dass Sie Ihren Vorrat inzwischen als zu gross einschätzen.
Trotzdem macht Ihnen der Schwund ihrer Ravioli Sorgen und Sie
beschliessen: Ab sofort wird nie wieder eine dieser Büchsen aufgemacht!
Diese Forderung schreiben Sie in Ihre Haushaltsverfassung und stellen sicher, dass der Grundsatz niemals umgestossen werden kann. (Wie Sie das wirklich sicher stellen können ist eine andere Frage, aber ich könnte Ihnen in meiner Spieltheorievorlesung ein paar Tipps geben.)
Die Jahre verstreichen, es folgen bessere und schlechtere Zeiten. Bisher bestand kein Grund, sich an Ihren Ravioli-Beständen zu vergreifen. Doch eines Tages tritt der Notfall ein: keine Nahrung weit und breit, die Welt ist in der Krise. Sie leiden Hunger und würden gerne an ihren Vorrat. Doch leider verbietet Ihnen der Ravioli-Artikel in Ihrer Verfassung den Zugriff. Sie werden mager und immer schwächer und schliesslich sterben Sie in Ihrem Keller, direkt vor dem prallgefüllten Lager an köstlichen Ravioli.
Jeder Mensch und erst recht jeder echte SVP-Schweizer weiss intuitiv, dass Ihre Ravioli-Initiative unsinnig war. Einen Notvorrat legt man an, weil die Absicht besteht, im Notfall auf ihn zurückzugreifen. Wie kommen die Initianten also darauf, einen solchen Unsinn zu fordern? Dazu muss man die Geschichte der Goldverkäufe der Schweizerischen Nationalbank kennen. Zurzeit besitzt sie noch 1040 Tonnen an Goldreserven. Im Verlauf der letzen 10 Jahre hat sie 1550 Tonnen verkauft allein in den Jahren
2000-2005 waren es 1300 Tonnen. Dieser Verkauf stand im Zusammenhang mit der Aufhebung der Goldbindung des Schweizer Frankens.
Die Initianten begründen Ihre Initiative mit eben diesen Verkäufen. Auch ich betrachte sie aus heutiger Sicht als einen Fehler. Im Nachhinein war das Timing falsch, weil ein grosser Teil der Bestände zu einem sehr niedrigen Preis veräussert wurde. Zudem lassen die Finanzkrise von 2007/2008 und die heute schwelende Schuldenkrise vermuten, dass die Bilanz der SNB heute besser da stünde, hätte sie damals nicht verkauft.
Aber im Nachhinein sind wir immer schlauer. Ende der 90er Jahre, als die Goldverkäufe beschlossen wurden, sah die Welt ganz anders aus. Die Ökonomen sprachen von „the great moderation“. Damit beschrieben sie den statistisch beobachtbaren Umstand, dass seit den 80er Jahren wirtschaftliche Krisen in hochentwickelten Volkswirtschaften milder ausfielen und seltener auftraten als früher. Zudem sass die Nationalbank auf Goldreserven, welche im Vergleich mit anderen Ländern äusserst hoch waren. Beide Umstände legten damals nahe, die Reserven an Gold (Ravioli) abzubauen.
Auch wenn man wegen den unglücklichen Goldverkäufen Sympathien für die Initiative entwickeln kann, sie ist fehl am Platz und kontraproduktiv.
Sie verbietet nicht nur, im Notfall auf die Reserven zurück zu greifen, sie schränkt die Anlage- und Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank durch ihre restriktive Vorgabe auch viel zu stark ein. Bei einer Annahme würde die Nationalbank einen Teil ihrer Unabhängigkeit verlieren, was allen Erkenntnissen der modernen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zuwider läuft. Diese zeigt nämlich, genau wie die praktische Erfahrung, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank unabdingbar ist für eine erfolgreiche Währung und somit für eine florierende Volkswirtschaft.
Unabhängigkeit bedeutet, die Schweizerische Nationalbank vor dem direkten Zugriff der Politik zu schützen. Oder wollen Sie tatsächlich, dass die Herren Reimann, Schlüer und Stamm die Politik unserer Nationalbank bestimmen? Diese Herren präsidieren das Initiativkomitee der neuen Goldinitiative, welche gerade den ersten Preis für die unsinnigste Initiative des Jahrzehnts erhalten hat