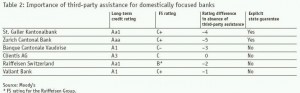Eben wurde ich von einer Journalistin darauf hingewiesen, dass die SP Schweiz dieses Wochenende die geplante Volksinitiative zur Einführung einer eidgenössischen Erbschaftssteuer debattieren wird. Mit diesem Thema hat sich die Partei einen Elfmeter herausgespielt, doch scheint sie sich anzuschicken, den Ball dem Torhüter zuzuschubsen.
Es gibt nämlich drei Arten, für eine neue Steuer zu plädieren. Im Normalfall liegt das ausschlaggebende Anliegen auf der Ausgabenseite, wofür es mittels höherer Steuern die entsprechende Finanzierung zu sichern gilt. So geschehen zum Beispiel bei der Volksabstimmung vom September 2009, als die Stimmbürger zwecks Sanierung der Invalidenversicherung eine Anhebung der Mehrwertssteuer billigten. Im Zentrum stand damals die IV; die Steuererhöhung wurde als vorübergehend notwendiges Übel geschluckt.
Neue Steuern lassen sich zweitens rechtfertigen, indem man dadurch andere, weniger effiziente, Steuern ersetzt. So geschehen beispielsweise, als die Mehrwertssteuer anstelle der alten Warenumsatzsteuer eingeführt wurde. Dieser Ansatz ist die hohe Torecke für die Befürworter einer eidgenössischen Erbschaftssteuer. Dass die Erbschaftssteuer aus volkswirtschaftlicher Sicht eine der schmerzlosesten Formen staatlicher Mittelbeschaffung darstellt, liegt nämlich auf der Hand. Solange sich der Staat bei Grosserben Mittel holt und dadurch andere, leistungs- und konsumhemmende, Steuern senkt, ist daran aus Effizienzüberlegungen schwer etwas auszusetzen. Die Initianten wollen zwei Drittel des Erbschaftssteueraufkommens der AHV zukommen lassen. Gute Idee: So senke man die Lohnprozente im entsprechenden Umfang, oder das der AHV reservierte Mehrwertssteuerprozent. Oder man eröffne ein Sparkonto für die AHV, um der prognostizierten Finanzierungslücke vorzubeugen.
Aber nein, die SP scheint zur dritten Strategie Anlauf zu nehmen. Sie erachtet die Erbschaftssteuer als an sich schon wünschbar und denkt sich neue Ausgabenposten aus, für welche sie die neuen Einnahmen verwenden möchte. Im Zentrum der gegenwärtigen Argumentation der Parteistrategen stehen steigende Einkommens- und Vermögensungleichheiten, denen es ihrer Meinung nach entgegenszusteuern gilt. Die jüngste Abfuhr des Schweizer Stimmvolks gegenüber der „Steurgerechtigkeitsintiative“ hat gezeigt, dass mit solchen Umverteilungsargumenten keine Mehrheit zu gewinnen ist. Die Partei spielt offenbar mit dem Gedanken, die allfälligen neuen Steuereinnahmen für zusätzliche AHV-Leistungen einzusetzen. Die Rede ist von einer Flexibilisierung – sprich Herabsetzung – des Rentenalters.
Wenn sie an dieser Argumentation festhält, trachtet die Partei mit der Erbschaftssteuerinitiative also nach mehr Staat und nicht bloss nach einem intelligenter finanzierten Staat. Das wäre ein Schüssli in die wartenden Hände des (etwas rechts der Mitte positionierten) Torhüters.