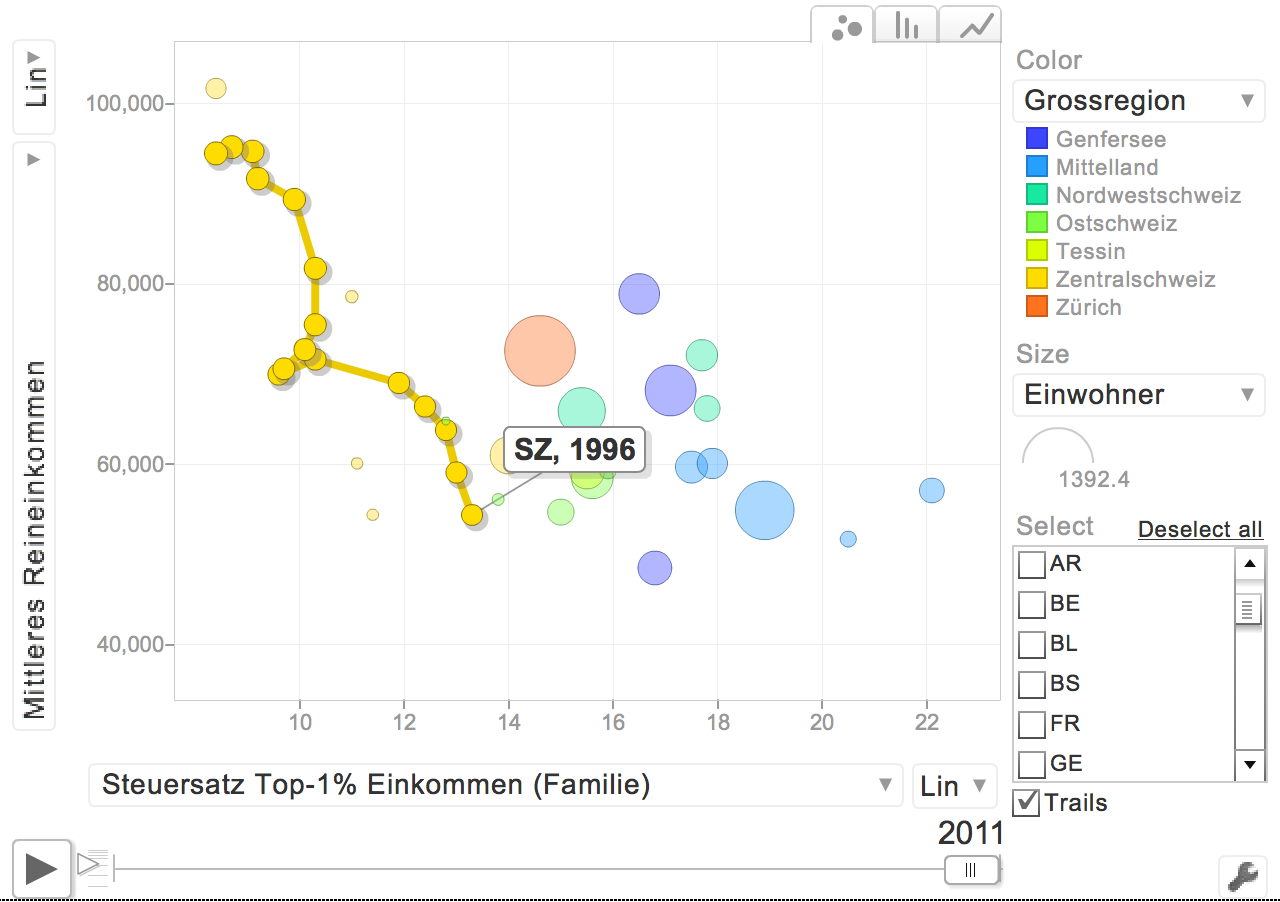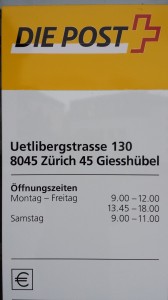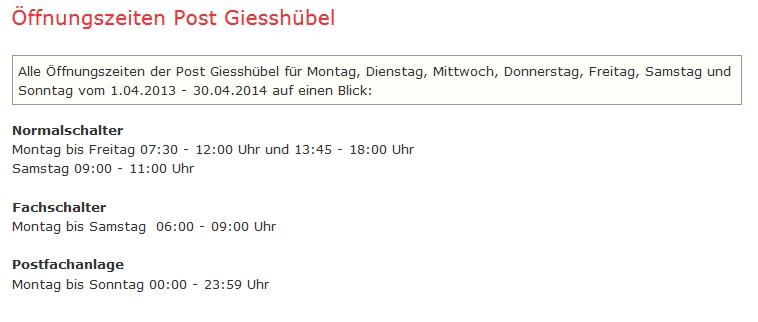Michel Habib und Monika Bütler
Stimmt es wirklich, dass die jetzige steuerliche Behandlung der mit der Kinderbetreuung verbundenen Kosten unfair ist gegenüber Familien, in denen ein Elternteil die Kinder selbst betreut?
Auf den ersten Blick scheint dies so zu sein. Diejenigen Familien, in denen beide Eltern arbeiten und wo die Kinder fremdbetreut werden, können einen Steuerabzug für die entstandenen Kosten geltend machen, während Familien, welche ihre Kinder selbst betreuen, kein solcher Abzug zur Verfügung steht.
Bei diesem Argument geht allerdings vergessen, dass bei Familien mit zwei Erwerbstätigen das Einkommen und damit auch das steuerbare Einkommen und die bezahlten Steuern ansteigen, während Familien, welche ihre Kinder selbst betreuen, ein tieferes Einkommen versteuern und damit auch weniger Steuern bezahlen. Da die höheren Steuern auf der einen Seite und der Steuerabzug auf der anderen sich gegenseitig aufheben, ist es nicht das jetzige System, welches unfair ist, sondern die vorgeschlagene Alternative.
Anders ausgedrückt: Ein Steuerabzug für selbstbetreuende Familien würde diesen eine Steuerersparnis bringen gegenüber den Familien, welche Fremdbetreuung in Anspruch nehmen, da letztere neben dem Abzug der Betreuungskosten auch noch ein erhöhtes Einkommen versteuern müssen.
Dieser Umstand lässt sich an einem Beispiel von zwei ähnlichen Familien verdeutlichen. Beide Väter verdienen 100‘000 CHF im Jahr, während eine der beiden Mütter Teilzeit arbeitet. Die Kosten für die Kinderbetreuung betragen 20‘000 CHF. Wenn man keine Wertung vornimmt über die Wünschbarkeit, Hausarbeit oder Erwerbsarbeit zu verrichten, scheint es intuitiv anzunehmen, dass die Mutter nur dann arbeitet, wenn sie mindestens 20‘000 CHF (plus die anderen Berufsauslagen) verdienen kann, und nicht arbeitet, wenn der Verdienst geringer ist. Doch diese Rechnung geht nur mit der heutigen Regelung auf, nicht aber mit dem vorgeschlagenen System.
Dies lässt sich einfach zeigen an der Steuerbelastung der beiden Familien im Fall. bei dem der zusätzliche Verdienst der Mutter netto genau 20‘000 CHF beträgt. In der heutigen Regelung ist das Einkommen nach Steuern der beiden Familien heute gleich, weil der Zusatzverdienst der Mutter mit den Betreuungskosten verrechnet wird. Im vorgeschlagenen System der Initiative dagegen wäre das Einkommen nach Steuern unterschiedlich.
Nehmen wir der Einfachheit halber einen proportionalen Steuersatz von 20% an. Ginge man zusätzlich von einem progressiven Steuersatz aus, würde der geschilderte Effekt sogar noch grösser. Das Einkommen der selbstbetreuenden Familie vor Steuern beträgt im heutigen System 100‘000 CHF, nach Steuern 80‘000 CHF. Die Familie mit Fremdbetreuung hat ein steuerbares Einkommen von 120‘000 CHF – 20‘000 CHF = 100‘000 CHF, weil die Betreuungskosten abgezogen werden können. Das Einkommen nach Steuern beträgt ebenfalls 80‘000 CHF, genau der gleiche Betrag wie bei der ersten Familie.
Betrachten wir nun die Änderungen gemäss dem Vorschlag der Initiative. Für die fremdbetreuende Familie ändert sich nichts, das Einkommen nach Steuern beträgt weiterhin 80‘000 CHF. Weil es neu einen Abzug für Selbstbetreuung gibt (gehen wir einmal von 10‘000 CHF pro Kind aus), beträgt das steuerbare Einkommen bei zwei Kindern neu 100‘000 CHF – 20‘000 CHF = 80‘000 CHF, so dass die geschuldeten Steuern sich nur noch auf 16‘000 CHF belaufen und damit neu ein Einkommen nach Steuern von 84‘000 CHF zur Verfügung steht. Das verfügbare Einkommen der selbstbetreuenden Familie ist damit um 4000 CHF höher als das Einkommen der Familie mit Fremdbetreuung.
Es ist also nicht so, dass das gegenwärtige System den Familien mit Fremdbetreuung unter dem Strich einen Vorteil gewährt, weil diese Familien auf dem zusätzlichen Einkommen Steuern bezahlen. Ganz im Gegenteil ist es so, dass das vorgeschlagene System den selbstbetreuenden Familien einen Vorteil gewährt, weil sie Steuerabzüge geltend machen könnten, denen keine Steuerzahlung gegenübersteht.
Ausgeblendet haben wir bei unserem vereinfachten Beispiel die Steuerprogression und die Abzüge, die bei einigen Kantonen und dem Bund für den Zweitverdienst gemacht werden können. Letztere sind in erster Linie gedacht, die starke Progression in der Steuerbelastung des Zweitverdiensts etwas abzumildern. Die beiden Effekte – Progression und Zweitverdienerabzug – gleichen sich etwa aus. Doch selbst in unserem Beispiel mit proportionalen Steuern (also ohne Steuerprogression), würden die Steuerersparnisse für den Zweitverdienst von circa 1000 CHF nie reichen, um den durch den SVP Vorschlag gewährten Steuervorteil für die selbstbetreuende Familie auszugleichen. (In Klammern bemerkt: Der Pauschabzug für den Zweitverdienst bei der Bundessteuer ist natürlich ein Unding. Er bestraft faktisch die Mehrarbeit des Zweitverdieners, die Steuerprogression wird nur für ein sehr geringes Arbeitspensum ausgeglichen).
Übersetzung einer ersten Version des Beitrags aus dem Englischen: Christian Marti (herzlichen Dank!)