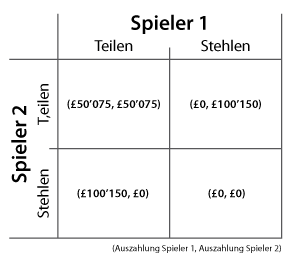Inke Nyborg
Diese Tage ist es leicht zu vergessen, dass es nicht nur einen Liborsatz gibt, sondern viele. Der Liborsatz, der zur Zeit unter Investigation steht, und der auch gestern wieder im Mittelpunkt der Fragenrunde des Finanzausschusses im britischen Unterhaus steht, ist essentiell der US-Dollar 3-Monats- Libor. Es gibt jedoch, wie bekannt, noch viele mehr. Je nach Währung und Laufdauer bestimmen 7 bis 18 Banken die verschiedenen Liborsätze. Das scheint auf dem ersten Blick kompliziert, summiert es sich doch bei 10 Währungen und 15 Laufdauern schnell zu 150 verschiedene Sätzen. Festgelegt wird der Libor jedoch durch eine relativ einfache Kalkulation („trimmed arithmetic mean“): Die höchsten und tiefsten 25% von den Banken gebotenen Werte werden gestrichen; aus dem Rest wird das arithmetische Mittel errechnet. Dieses Verfahren wurde so bestimmt, weil es durch die Eliminierung der Sonderfälle – laut der British Bankers‘ Association – das Risiko zur Manipulation am geringsten hält. Jedoch zeigte bereits vor zwei Jahren ein Paper von Rosa M. Abrantes-Metz, Sofia B. Villas-Boas und George G. Judge mit Hilfe des Benfordschen Gesetzes auf, dass sich die Liborsätze zwischen 2005 und 2008 überaus verdächtig verhielten. Das Benfordsche Gesetz, auch bekannt als Newcomb-Benford’s Law, steht für eine bestimmte Gesetzmässigkeit in der Verteilung der Ziffernstrukturen von Zahlen in empirischen Datensätzen. Doch wie es scheint braucht es keine speziellen statistischen Kentnisse, um Zweifel an der Objektivität der Liborfestlegung zu haben. Neue Forschung von Andrew Verstein, welche zum Ende des Jahres im Yale Journal on Regulation erscheinen wird, deutet an, dass eine Manipulation von Libor auch ohne eine kartellähnliche Absprache unter den teilnehmenden Banken möglich ist. Versteins Arithmetik zu wie eine Bank alleine von einem Tag auf den anderen den Liborsatz um ausschlaggebende Prozentpunkte beeinflussen kann ist erstaunlich einfach und durchaus plausibel – und kann hier nachgelesen werden.