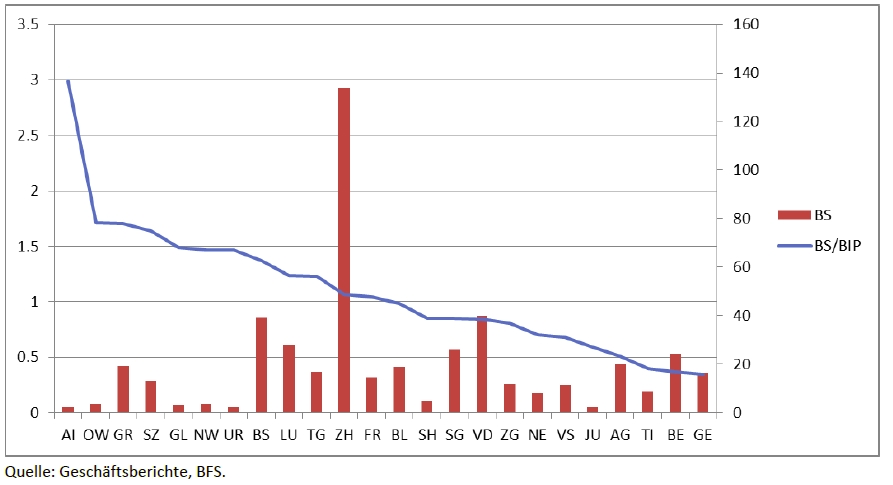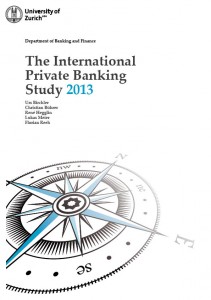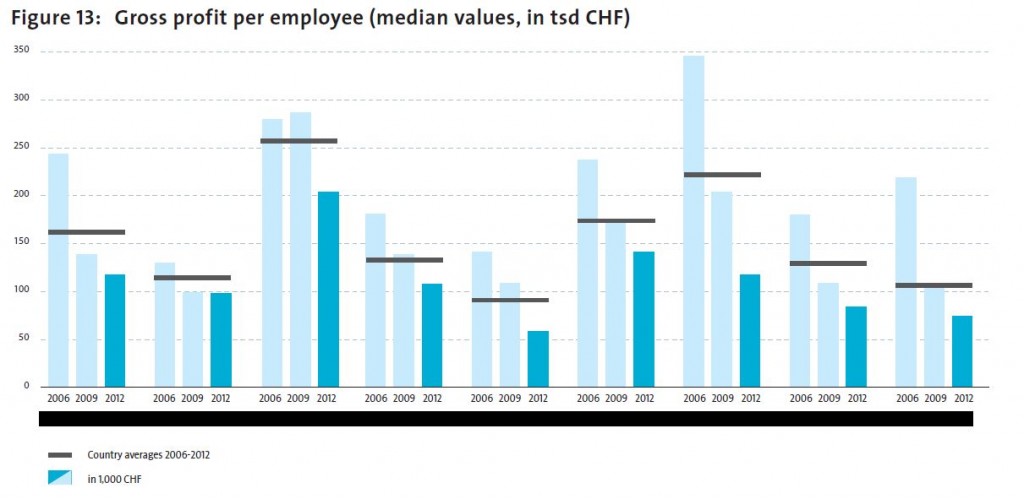Urs Birchler
Die Anträge der Zürcher Kantonalbank vom Januar 2013 sind in der vorberatenden Kommission des Kantonsrates (Spezialkommission ZKB) auf wenig Gegenliebe gestossen. Auch der Regierungsrat hat eher negativ reagiert. Als nächstes ist der Kantonsrat gefordert.
Leider haben die Kritiker weitgehend recht. Eine Studie des Zentrums für Finanzmarktregulierung der UZH kommt zum Schluss, dass die Argumente der ZKB nicht überzeugen.
Hier ein Management Summary:
- Angesichts der Wachstumsstrategie der Geschäftsleitung ist zu bezweifeln, ob eine Erhöhung des Dotationskapitals zur Stärkung der Sicherheit der Bank und nicht zur Expansion verwendet wird.
- Die angestrebte Diversifikation durch Wachstum über den Kanton hinaus führt nicht unbedingt zu geringeren Risiken.
- Die ZKB verwirft die Aufnahme privaten Kapitals, namentlich von nachrangigen Schulden mit bedingtem Forderungsverzicht, mit untauglichen Argumenten.
- Die vorgesehene Abgeltung der Staatsgarantie ist viel zu optimistisch berechnet.
Ich bin gespannt, wie der Kantonsrat die Argumente der ZKB beurteilen wird.