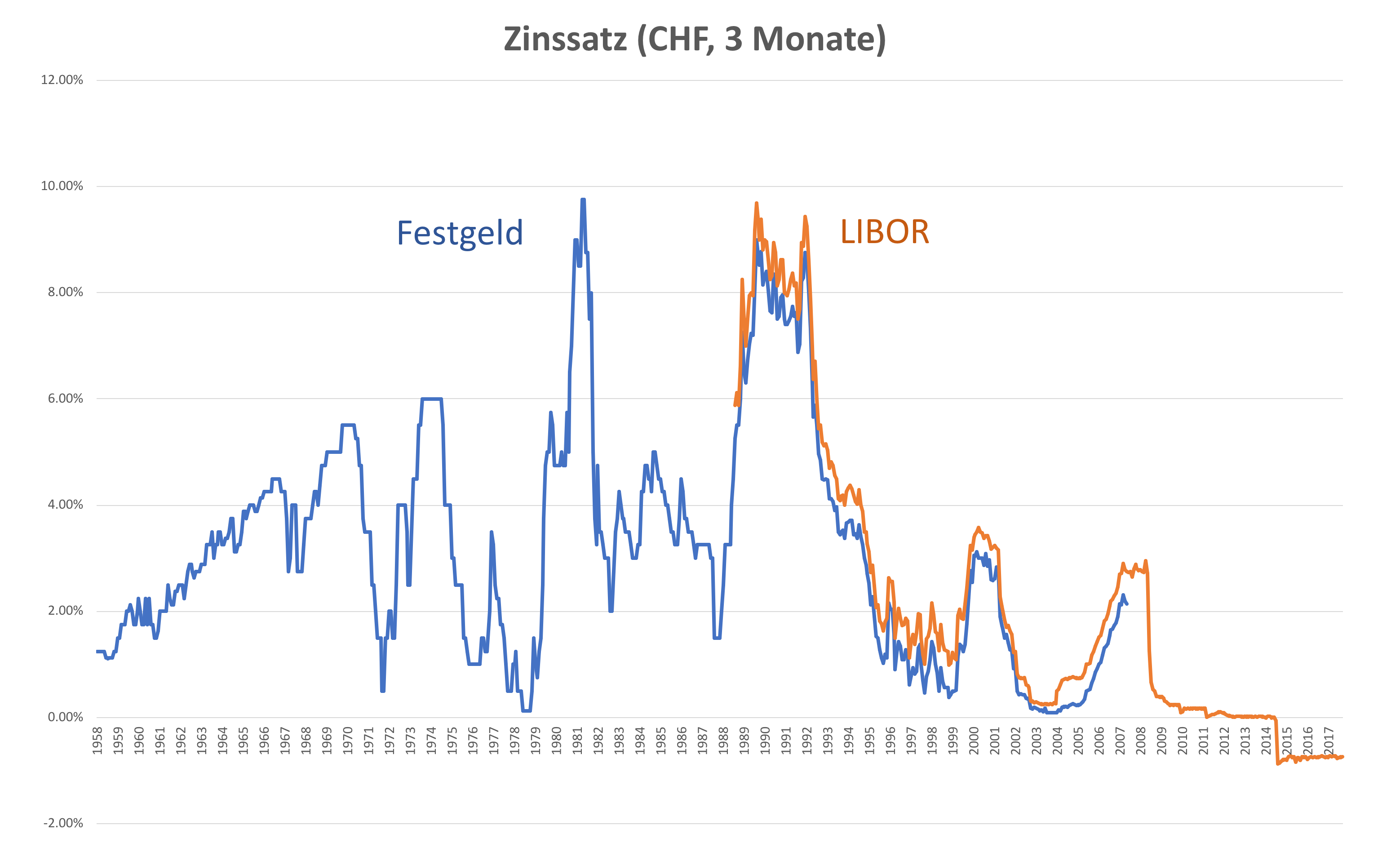Urs Birchler
Immer wieder kommt die Frage: „Warum dürfen Banken Geld schöpfen, aber andere nicht?“ Die Vollgeldbewegung will die Geldschöpfung der Banken abschaffen, und an der kommenden Generalversammlung der SNB wird das Thema sicher von verschiedenen Referenten aufgegriffen werden. Heute kam mir ein Text von Ivo Muri in die Hand: „Warum dürfen Landwirte kein Geld drucken?“ Drum versuche ich am Beispiel der Kartoffelwährung einmal mehr zu erklären, was Banken tun und was nicht.
Bauern verkaufen Kartoffeln. Banken verkaufen Guthaben. Mit Kartoffeln kann man zahlen, wenn jemand bereit ist, Kartoffeln an Zahlung zu nehmen. Dasselbe gilt für Bankguthaben. Ein potentielles Zahlungsmittel herstellen darf also jeder (Beispiel: Bitcoins); schwieriger ist es, die Leute zu überzeugen, dieses effektiv anzunehmen. In Kuba sind Kartoffeln ein sehr begehrtes Zahlungsmittel. In der Schweiz sind heutzutage Bankguthaben beliebter.
Fazit 1: Geld wird geschaffen durch die Bereitschaft der Allgemeinheit, ein Gut als Zahlungsmittel anzunehmen. Geld schafft also weder der Bauer noch die Bank, sondern wir, die uns durch Guthaben oder Kartoffeln zahlen lassen.
Kartoffeln bestehen aus Stärke. Bankguthaben bestehen aus versprochenem Geld. Der Unterschied: Stärke macht satt, ein Versprechen nicht. Wie J.A. Schumpeter sagte: Mit versprochenem Geld kann man bezahlen, aber auf einem versprochenen Pferd kann man nicht reiten. Mit versprochenen Kartoffeln kann man also zwar nicht kochen. Aber (siehe oben) man kann mit ihnen bezahlen, wenn das Lieferversprechen des Bauern glaubwürdig genug ist.
Fazit 2: Geld kann jeder schaffen, der glaubwürdige Versprechen abgeben kann und diese in eine übertragbare Form kleidet.
Kartoffeln kriegen Junge. Geld kriegt keine Jungen, aber es „arbeitet“, d.h. es lässt sich rentabel ausleihen. Bauer und Bank lassen ihre Kartoffeln, bzw. ihr Geld, daher nicht in der Scheune liegen. Das hat einen Vorteil: Die Inhaber der Kartoffelgutscheine und die Inhaber der Bankguthaben erhalten einen Zins (oder Dienstleistungen im Zahlungsverkehr). Im Wettbewerb frisst dieser Zins den Ertrag aus dem ausgeliehenen Geld, bzw. des gepflanzten Kartoffeln weitgehend auf, d.h. der Ertrag der Geldschöpfung fliesst in jenes Publikum, auf dessen Vertrauen die Geldschöpfung letztlich beruht. Dieses System — versprochene Kartoffeln nicht am Lager zu haben oder versprochenes Geld auszuleihen — hat auch einen Nachteil: Es ist fragil. Wenn Panik aufkommt, versuchen die Leute, die Kartoffeln im eigenen Keller zu bunkern oder das Geld bei der Bank in bar abzuholen. Dies ist die Achillesferse des „fractional reserve banking“.
Fazit 3: Unvollständig gesicherte Guthaben sind für ihre Inhaber rentabel, aber riskant. Ob die Guthaben auf Kartoffeln lauten oder auf Geld spielt keine Rolle.
Geld (in heutiger Form) ist beliebig vermehrbar. Kartoffeln nicht. Einem Bauern, der Kartoffel versprochen hat, sie aber nicht liefern kann, mag ein Kollege aushelfen. Wenn alle Bauern „short“ sind, kann ihnen niemand helfen. Wenn alle Banken zusammen Geld liefern müssen, weil die Kunden in Panik sind, kann ihnen die Nationalbank mit einem Notkredit helfen. Die Nationalbank — und nur die Nationalbank — schafft Geld „gratis“ aus dem Nichts. Fiat Money, „Es werde Geld“. Es werde Kartoffel, geht nicht. (Dasselbe gilt übrigens für Bitcoin, darum kann und wird es nie echte Bitcoin-Banken geben.) Einen Lender of Last Resort kann es nur geben in einem beliebig vermehrbaren Medium, d.h. in Fiat Money. Weil Banken (von der SNB geschaffenes) Fiat Money borgen und ausleihen und nicht Kartoffeln, sind sie anders als Bauern. Und die SNB schützt die Achillesferse des Systems (was man als Vollgeld durch die Hintertür bezeichnen könnte).
Fazit 4: Das einzige „Privileg“ der Banken besteht darin, dass ihre Versprechen auf Geld lauten, welches im Notfall von der Notenbank beliebig vermehrt werden kann (den Banken aber keineswegs geschenkt wird).
Eine Hunderternote zu drucken, kostet die Nationalbank weniger als einen Franken. Das rentiert. Kartoffelgeld oder Bankgeld zu schaffen, ist etwas ganz anderes: Die Halter von Guthaben bei Bank oder Bauern müssen nämlich „bestochen“ werden, sei es (siehe oben) in Form von Zinsen oder Dienstleistungen im Zahlungsverkehr. Sonst gehen sie zur Konkurrenz. Die Nationalbank hingegen hat keine direkte Konkurrenz, drum braucht sie den Inhabern der Banknoten auch keinen Zins zu bezahlen. (Den resultierenden Gewinn überweist sie im wesentlichen an Bund und Kantone.)
Fazit 5: Geldschöpfung durch die SNB einerseits und durch Banken (oder Bauern) andererseits sind zwei grundverschiedene Vorgänge.