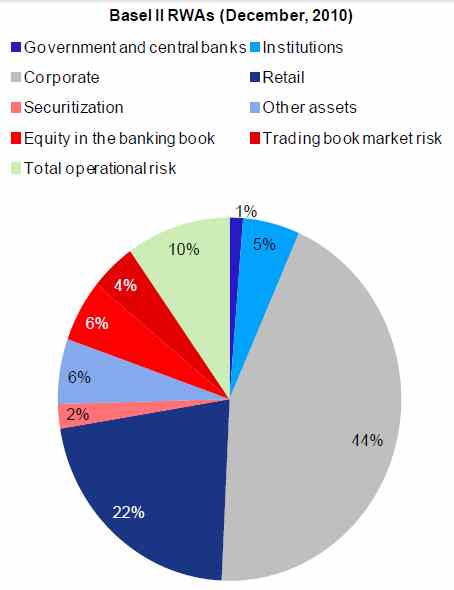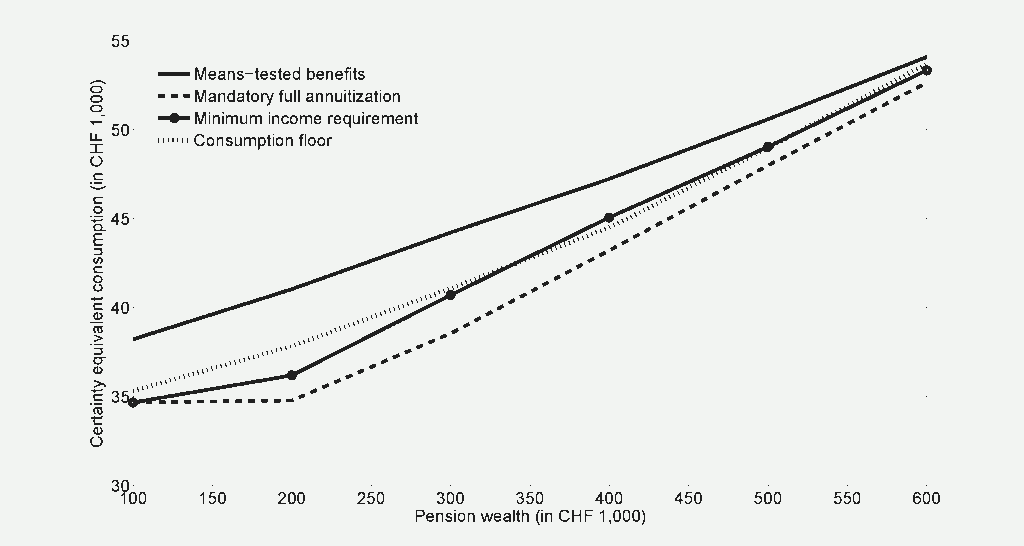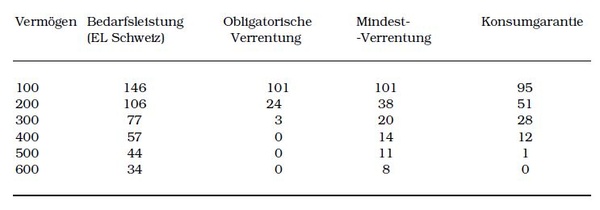Urs Birchler
Das VBS legt eine Studie vor zu Kosten und Nutzen der Armee. Leider enthält die Studie einen ökonomischen Blindgänger, den es zu entschärfen gilt.
Einmal mehr (wie oft noch?) kommt das Argument, die Ausgaben eines Wirtschaftsteilnehmers (hier der Armee) seien wertvoll, weil sie Einnahmen für Arbeitnehmer oder für andere Wirtschaftssektoren darstellen. Die Studie sprich von 1,4 Mrd. Fr., die die Armee als Arbeitgeberin für 14’000 Arbeitsplätze ausgibt, sowie von 2,5 Mrd. Fr., die an Lieferanten fliessen (S. 38, Originaltext unten).
Dies ist genau so alt, wie falsch. Wir haben das in batz.ch schon hier, am Beispiel der Cleantech-Initiative der SP (die mit demselben Trick arbeitet), erklärt und hier, mit Hinweis auf einen Artikel von Reto Föllmi, erwähnt. Ob die Ausgaben eines Sektors (z.B. Gesundheit) Kosten oder Nutzen darstellen, ist im übrigen Ansichtssache; dies liegt im Wesen der doppelten Buchhaltung.
Die richtige Frage ist, ob die Armee ihr (unser) Geld sinnvoll ausgibt oder nicht. Die Studie enthält dazu einiges; überzeugender wäre dieses ohne pseudo-volkswirtschaftliche Nebelpetarden.
————————————————————————————-
Nutzen als Auftraggeber der zivilen Wirtschaft (2,5 Mrd. CHF 24):
„Die jährlichen Rückflüsse der Armee zu Gunsten der Privatwirtschaft sind mit 2,8 Mrd. CHF bedeutend. Davon fliessen 0,3 Mrd. CHF ins Ausland ab, was aber über Offset-Geschäfte wieder kompensiert wird. Von den im Inland verbleibenden 2,5 Mrd. CHF werden beispielsweise durch Rüstungsaufträge ca. 13.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt in der Rüstungsindustrie und in rüstungsnahen Bereichen beschäftigt. Massgeblich von Armeeaufträgen profitieren Unternehmen wie z.B. Bereiche der Rheinmetall-Gruppe, die MOWAG (General Dynamics), die Pilatus Flugzeugwerke AG, die THALES Schweiz, ATOS Schweiz (früher Siemens) oder der Technologiekonzern RUAG. Die Armee fördert jedoch nicht nur rüstungsnahe Unternehmen, sondern lässt durch Investitionen und Unterhaltsarbeiten an Immobilien und Verkehrsinfrastruktur, über Materialbeschaffungen, Verpflegungseinkäufe sowie Truppenkonsumationen ihre Ausgaben mit hoher Breitenwirkung in die Volkswirtschaft der Schweiz zurückfliessen.“