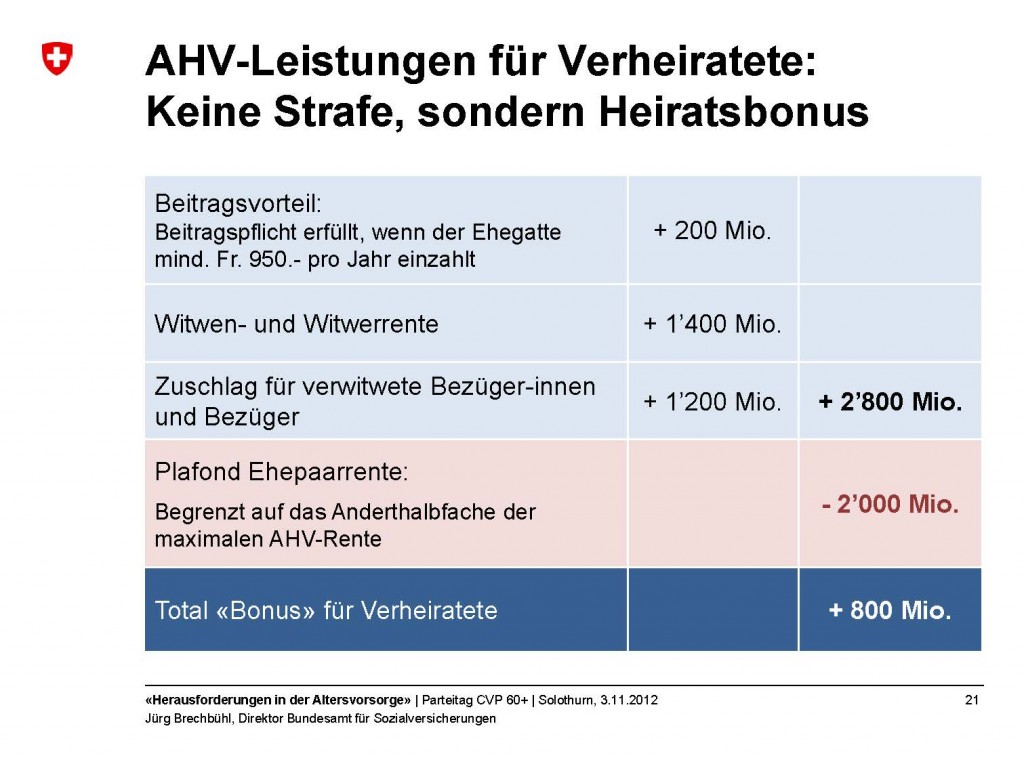… oder von der Senkung des Umwandlungssatzes durch die Hintertüre
Monika Bütler
publiziert in der NZZ am Sonntag, 2. Dezember 2012
„Wenn ich sage, die Brücke hält, dann hält die Brücke!” Man muss den Film Der General (1926) von und mit Buster Keaton gar nicht gesehen haben, um das Ende zu erahnen. Die Brücke hält nicht. Wir lachen über den unglücklichen Befehlshaber und sind ihm doch verwandt: Der Glaube, Markt- und Naturkräfte durch Willen auszuhebeln, ist offenbar angeboren.
Aktuelles Beispiel: Der Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge. Dieser beträgt noch immer 6.8%. Bei einem Zinssatz von 2% reicht das bis zur Pensionierung angesparte Vermögen (ohne Verwaltungskosten!) nur für weitere 17 Lebensjahre. Also allerhöchstens noch für unverheiratete Männer; die einzige Gruppe übrigens, die ihre Kosten selber deckt. Alle anderen – Frauen und verheiratete Männer – beziehen direkt oder indirekt über ihre Witwen im Schnitt zusätzlich 4-5 Jahre Rente.
Doch während sich weite Kreise gegen jede Senkung des Umwandlungssatzes wehren, beginnen Pensionskassen reihum, einschneidende Massnahmen zu treffen, die im Endeffekt genau diese Senkung vollziehen. Einfach durch die Hintertür.
Die Kassen können sich den überhöhten Satz nämlich schlicht nicht leisten und müssen ihn irgendwie senken. Verschiedene Wege stehen offen, alle ganz legal. Eine Möglichkeit ist die harte Sanierung. Ein typisches Paket: Zusätzliche 2%-Beiträge für Arbeitgeber und Versicherte plus Reduktion der Mindestverzinsung um 0.5% während 5 Jahren. Dies wirkt wie eine Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8 auf 6.4%. Für jüngere Versicherte ist der Verlust wegen den Zinseffekten noch grösser; zudem müssen sie unter Umständen mehr als einmal eine Sanierung mitfinanzieren.
Sanfter ist die Reduktion über die Verwischung von Überobligatorium und Obligatorium. Solange die gesetzlichen Leistungen erbracht werden, darf der Umwandlungssatz einer sogenannt umhüllenden Kasse (ohne explizite Trennung zwischen Obligatorium und Überobligatorium) nämlich tiefer sein als der gesetzliche Umwandlungssatz.
Zudem haben die Kassen einen Anreiz, bestimmte Vorsorgegelder (Zahlungen bei Stellenwechsel oder Deckung von Beitragslücken nach Scheidung und Arbeitslosigkeit) im für sie „billigeren“, für die Versicherten aber schlechteren Überobligatorium zu verbuchen. Je unrealistischer der gesetzliche Umwandlungssatz, desto grösser der entsprechende Druck auf die Kassen.
Zu guter Letzt besteht die Gefahr, dass die Kassen den Versicherten mindestens nicht ausreden, das angesparte Kapital bei der Pensionierung in bar zu beziehen. Damit fällt das Problem des richtigen Umwandlungssatz weg, allerdings auch die Versicherung der Langlebigkeit. Gehen den Versicherten im Alter die Mittel aus, zahlt die Allgemeinheit mit Ergänzungsleistungen.
Kurz: Wir können zwar befehlen „Der Satz hält!“, doch die demografische Schwerkraft ist stärker: Entweder wir senken den Satz, offiziell, transparent und regelgebunden. Oder –– wir halten an ihm fest. Dann sinkt er versteckt und unkontrolliert.
Im Sinne einer effizienten, gerechten und transparenten Vorsorge ist dies sicher nicht. Umso erfreulicher, dass unser Innenminister bei seinem Vorschlag zur Reform der Alterssicherung sowohl eine Senkung des Umwandlungssatzes wie auch mehr Transparenz fordert.
Buster Keaton verzichtete für die berühmte Brückenszene übrigens auf ein Modell. Der echte Zug, der die Brücke überqueren sollte, stürzte mit ihr in die Tiefe. Die Szene gilt als teuerste der ganzen Stummfilmzeit, das Zugswrack blieb während Jahrzehnten eine Touristenattraktion. Noch könnten wir in der beruflichen Vorsorge an einem Modell üben. Beharren wir aber auf dem heutigen Umwandlungssatz, nehmen wir den Absturz der echten Beruflichen Vorsorge in Kauf. Sie wird dann allerdings nicht zur Touristenattraktion, höchstens zu einer Fallstudie. Und zu einer Falle für die Jungen: Sie ist nämlich – im Gegensatz zu Buster Keatons Zug – bemannt.