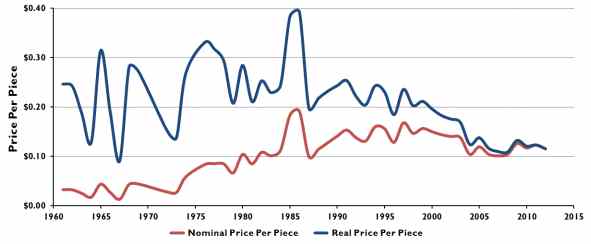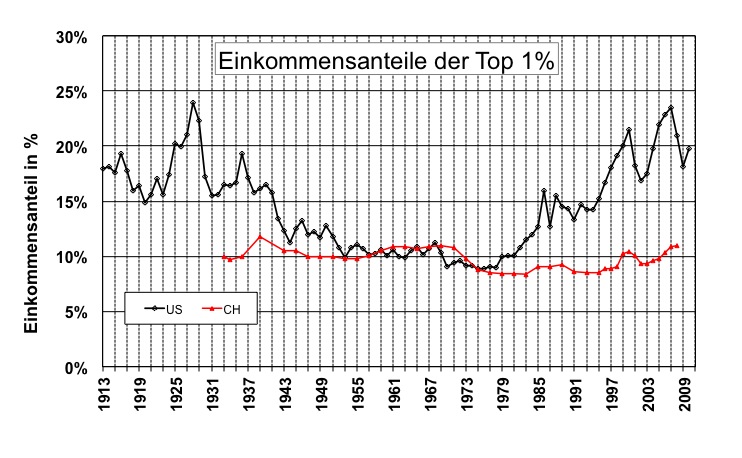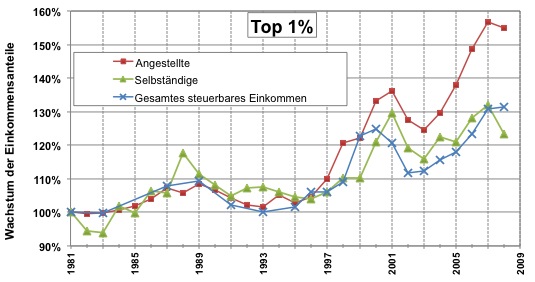Monika Bütler
Der Schweiz geht es offensichtlich blendend. In Zeiten knapper Kantonsfinanzen kann sie sich eine 60-köpfige Kommission leisten (davon 20 Behördenmitglieder aus den Kantonen), welche Filme für Kinder und Jugendliche prüft und entsprechend freigeben kann. Bahnbrechende Neuerung: Das Mindestzutrittsalter gilt neu einheitlich für die ganze Schweiz – oder mindestens fast, weil Zürich und der Tessin noch ausscheren.
Eine unter dem Namen Jugendschutz verkaufte Regulierung macht ohnehin wenig Sinn, wenn sie nur dort wirklich bindet – im Kino nämlich –, wo die soziale Kontrolle bereits gross ist. Alle Filme können bequem zu Hause angeschaut werden. Darüber habe ich in einer Kolumne für die NZZaS („Im falschen Film“) schon mal ausführlich geschrieben.
Weshalb aber eine einheitliche Regelung so wünschenswert ist, bleibt schleierhaft. Normierungen und Harmonisierungen machen Sinn, wenn unterschiedliche Regelungen die Mobilität der (Berufs-)Leute einschränken und den Wettbewerb stören. Beispiele für sinnvolle Harmonisierungen sind die schweizweite Anerkennung von Berufspatenten oder die partielle Angleichung der Lehrpläne zwischen den Kantonen. Als ich noch klein war, konnte eine Familie nicht umziehen, weil für die Kinder der Schulwechsel zu kompliziert und das Lehrerpatent der Mutter im Nachbarskanton nichts wert war.
Doch wo genau liegen denn die Gründe für eine Vereinheitlichung des Mindestalters? Niemand wird nicht von Zürich wegziehen können, weil das Zutrittsalter für den Film „More than Honey“ in Bern 8 Jahre, in Basel 10 Jahre statt wie in Zürich 6 Jahre beträgt. (Wie klein die Harmonisierungsmarge ist, zeigt sich schon daran, dass alle Journalisten genau diesen Film als Beispiel wählten). Psychische Schäden durch die Verunsicherung ausgelöst durch unterschiedliche Zugangsalter sehe ich beim besten Willen auch nicht, weder für Eltern noch für Kinder.
Wir versuchen unseren Studierenden, darunter viele Juristen, schon zu Beginn des Studiums beizubringen, dass es zur Begründung einer Regulierung ein Marktversagen braucht; Externalitäten, Verhinderung des Wettbewerbs usw. Zu sehen davon ist leider wenig. Das Zutrittsalter zu den Kinos mag ein unbedeutendes Beispiel für eine sinnlose Regulierung ohne überzeugende Begründung sein. (Es nähme mich allerdings dennoch Wunder, wer diese 60-köpfige Kommission bezahlt). Es illustriert aber wunderbar die zunehmende Verdrängung des gesunden Menschenverstandes durch eine überbordende Bürokratie.
Bald in diesem Kino: Im falschen Film, Teil 3 (Anzahl der Folgen noch unbestimmt)