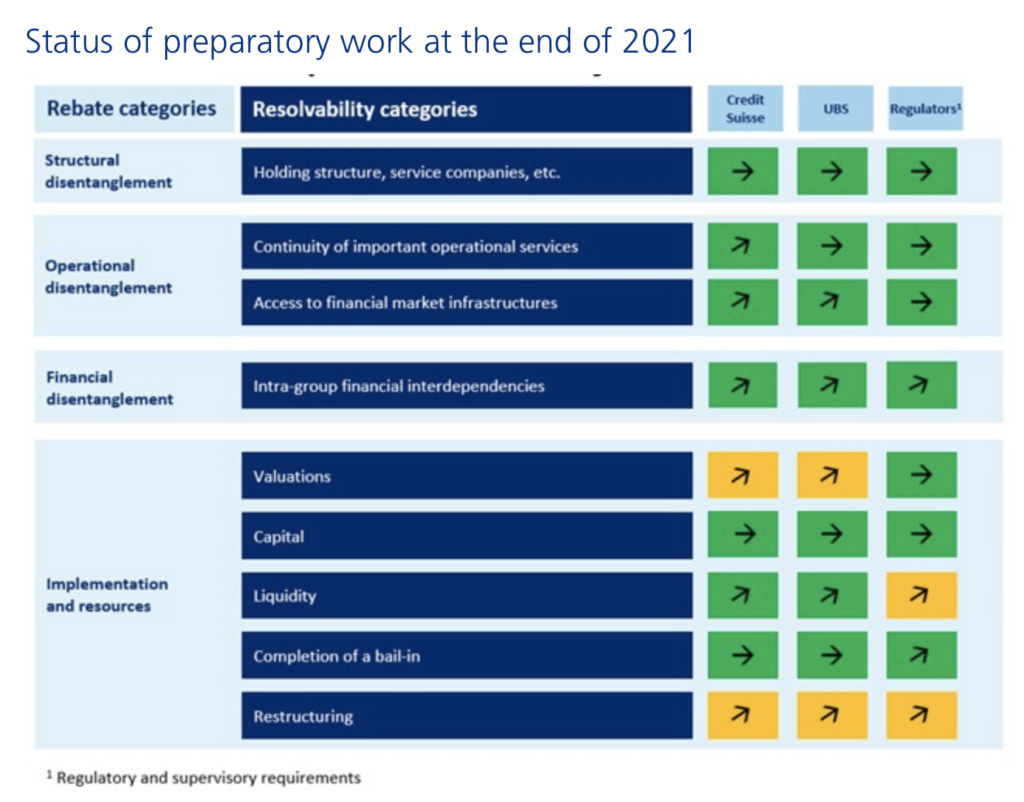Verzichten wir auf Brandmauern zwischen den Häusern und stellen statt dessen vor jedes Haus einen Hydranten! Dies streben grosse Banken hinter den Kulissen seit Jahren an: Möglichst wenig Eigenmittel (Brandmauern), aber unbeschränkte Liquiditätsgarantien (Hydranten). Heute stehen sie knapp vor dem Ziel — paradoxerweise, weil eine von ihnen falliert ist.
Beim Untergang der Credit Suisse gab die SNB Liquiditätszusagen gestützt auf Notrecht ab. Der Bundesrat möchte solche ungedeckte Hilfskredite an grosse Banken durch die Nationalbank mit Bundesgarantie (im Jargon der Bankenregulierung: Public Liquidity Backstop, PLB) künftig unter ordentlichem Recht ermöglichen. Egal, wenn die Feuerwehr ausrücken muss.
Der Hintergrund: Wenn die Kunden einer Bank ihr Geld abholen, hat diese bald keine liquiden Mittel mehr, steht also mit leerer Kasse da. Dann kann sie bei der SNB noch Notkredite gegen Deckung erbitten. Wenn sie aber nichts mehr besitzt, was die SNB mit halbwegs gutem Gewissen belehnen kann, dürfte – gemäss Vorlage — die Nationalbank der klammen Bank trotzdem nochmals Geld leihen, und zwar blanko, falls im Hintergrund der Bund bürgt. Daher: Public (SNB und Bund) + Liquidity (es gibt Geld) + Backstop (das Auffangnetz hinter dem Werfer beim Baseball).
Die vom Bundesrat zur Umsetzung des PLB erarbeitete Vorlage weist gravierende Schwächen auf und sollte nicht vorschnell umgesetzt werden. Die Gründe:
- Die Vorlage ist – zusammen mit den aus der CS-Krise noch bestehenden Bestimmungen – viel zu komplex. Für Nicht-Spezialisten sind die konzeptionellen Schwächen kaum erkennbar. Die geplante Trennung der Vorlage von der geplanten umfassenderen Revision der TBTF-Bestimmungen verhindert eine Regulierung „aus einem Guss“.
- Der PLB subventioniert die systemrelevanten Organisationen (UBS, Raiffeisen Gruppe, Zürcher Kantonalbank und PostFinance) gegenüber den kleineren Banken wie z.B. den Regionalbanken. Die vorgesehene Abgeltung (Versicherungsprämie) ist zu tief. Sie ist geringer als die Abgeltung für die Staatsgarantie, welche die Kantonalbanken ihren Kantonen zahlen (zusätzlich zur Erfüllung des Leistungsauftrags und zur Dividende!). Zudem ist die Abgeltung an die Kantone ohnehin schon eher tief gemessen an den statistischen Erfahrungswerten zu Verlusten der Kantonalbanken.
- Ein Konkursprivileg für Kredite durch die SNB macht die bereits ziemlich komplizierte Hierarchie der Ansprüche von Einlegern, Träger der Einlagensicherung (esisuisse) und SNB durcheinander (hierzu nur ein Beispiel). Die daraus folgenden rechtlichen Komplikationen erschweren eine Sanierung oder geordnete Abwicklung einer Bank zusätzlich.
- Der PLB bringt schafft (entgegen der Behauptung in der Vorlage des Bundesrates) kein zusätzliches Vertrauen der Fremdkapitalgeber, im Gegenteil. Beruhigend wirkt Liquiditätshilfe durch die SNB nur, wenn die Solvenz der Bank ausser Zweifel steht, wenn also die Einleger bloss Angst voreinander haben. Bei zweifelhafter Solvenz jedoch bleibt für die letzten Einleger weniger übrig, wenn andere ihre Guthaben dank der Liquiditätshilfe durch die SNB zurückziehen. Ein sofortiger Rückzug (Bank Run) bei angebotener Liquiditätshilfe ist also rational.
- Liquiditätshilfe durch die SNB untergräbt die Rolle der FINMA. Illiquidität (Zahlungsunfähigkeit) eines Unternehmens ist in der Regel ein Zeichen für Insolvenz (Überschuldung). Anders als die Insolvenz lässt sich Illiquidität nicht verstecken. Sie ist die Guillotine: Die Unternehmung muss in neue Hände kommen. Bei Banken ist die Guillotine jedoch sehr teuer, auch volkswirtschaftlich. Deshalb gibt es eine Bankenaufsicht, die rechtzeitig eingreifen soll, wenn die Solvenz gefährdet ist. (Zu) grosszügige Liquiditätshilfe durch die SNB ermöglicht es aber der FINMA, die Illusion der Solvenz aufrechtzuerhalten Beispiel CS). Hier liegt sogar ein Fehlanreiz vor: Die SNB darf Liquiditätshilfe gewähren, solange die FINMA die Solvenz der empfangenden Bank noch bescheinigt. Der PLB verschlimmert das Problem noch.
- Die an eine Liquiditätshilfe unter dem PLB obligatorisch zu knüpfenden Sanierungsmassnahmen sind nicht genügend spezifiziert. Da Liquiditätshilfe das Leben einer möglcherweise insolventen Bank verlängert, schafft dies eine Lücke in der Unternehmenskontrolle.
- Die Gewährung von ungedeckten Krediten mit Bundesgarantie ist ökonomisch gleichbedeutend wie eine Kreditgewährung der SNB an den Bund (und von diesem an die Bank). Ob dies eine illegale Staatsfinanzierung (Art. 11 Abs. 2 NBG) darstellt, wäre mindestens genau zu prüfen.
- Unklar ist (mindestens für den Ökonomen), ob die vorgesehenen Bestimmungen (Art. 51a) nur die vergangene Kreditgewährung betreffen (wodurch sie überflüssig wären) oder auch eine Verpflichtung des Bundes zu künftiger Hilfeleistung enthalten (wesfalls sie gestrichen gehörten).
Trotz all dieser Mängel wurde die Vorlage des Bundesrates in der Vernehmlassung relativ positiv aufgenommen. Klar ist, dass die Bankiervereinigung, de facto das Sprachrohr der Grossbanken, das Geschenk des Bundes gerne annehmen möchte. Auch Economiesuisse findet den PLB eine gute Sache. Vielleicht hofft sie, irgendwann bekämen alle Schweizer Unternehmen im Krisenfall Bundesgarantie für Notkredite. Sogar der Kantonalbankenverband ist für den PLB, obwohl nur ein einziges seiner Mitglieder (die ZKB) von ihm profitieren kann — und ihn gar nicht braucht, da die Bank bereits von Gesetztes wegen Staatsgarantie geniesst. Das Kuriosum wird von Letti Robin (UniFR) analysiert. Der Regionalbankenverband schliesslich mag nicht gegen den PLB ankämpfen, sondern argumentiert, der PLB müsse auch den bisher ausgeschlossenen 98 Prozent der Schweizer Banken offenstehen.
Aus neutraler Warte wurde die Vorlage kaum kommentiert — sie ist schlicht zu kompliziert. Eine vorsichtig kritische Stimme erhob Christoph Schmutz in der NZZ. Schärfere Kritik kam von von Alexandra Janssen (Ecofin) und Adriel Jost und Corinne Zellweger-Gutknecht (UniSG/UniBa). Aymo Brunetti (UniBe) befürwortet zwar einen PLB, hält aber die vorgesehene Abgeltung für viel zu gering angesichts der Risiken für den Steuerzahler.
Fazit: Stop dem Back-Stop! Der Gesetzgeber täte gut daran, den PLB trotz Applaus durch die Banken nicht einfach durchzuwinken, sondern nochmals genauer anzusehen. Notwendig wäre mindestens eine Abstimmung zwischen Regeln zur Liquiditätshilfe und einer neuen TBTF-Regulierung. Auf Deutsch: Wieviel Brandmauer braucht es für ein Anrecht auf einen Hydranten?