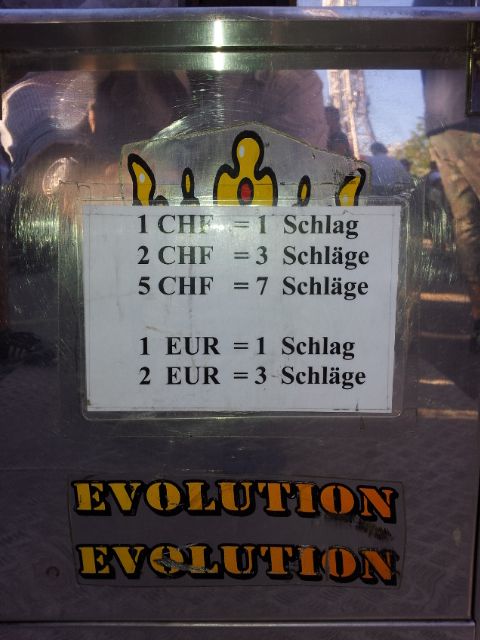Der Ständerat hat dem Nationalrat die heisse Kartoffel zugespielt: Sollen Parteien offenlegen, woher sie ihr Geld erhalten?
Dazu gibt es die umgekehrte Fragestellung: Sollen Firmen ihre Parteispenden offenlegen? Dazu hat die Harvard Law School kürzlich eine interessante Studie (verfasst von John Coates und Taylor Lincoln) präsentiert. Der Befund: Unternehmen, die freiwillig ihre Parteispenden offenlegen, haben im Durchschnitt um 7,5 Prozent höhere market-to-book-ratios (Marktkapitalisierung dividiert durch Eigenkapital). Das heisst, die Offenlegung liegt im Interesse der Aktionäre (vermutlich dienen nicht alle Spenden der Unternehmung, sonder eher dem Freundschaft-Netzwerk der Geschäftsleitung). Gefunden habe ich die Studie über den Eintrag von James Kwak in The baseline scenario.
Die Schweizer Unternehmen könnten dem Nationalrat die Arbeit daher etwas erleichtern. Umgekehrt könnte der Nationalrat mit der Offenlegung den Aktionären der Spender-Firmen einen kleinen Gefallen tun.