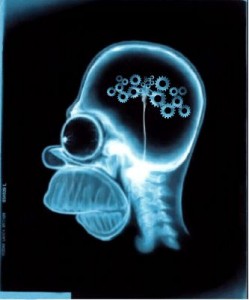Alt wird zu teuer für die Pensionskassen. Wie in der Schweiz wird in den Niederlanden heftig über die Zukunft der Beruflichen Vorsorge gestritten. Interessanterweise gleichen sich die Systeme in den Niederlanden und der Schweiz sehr stark. So wird in beiden Ländern viel Wert auf Leistungsgarantien – Mindestverzinsung und Umwandlungssatz – gelegt. Und wie überall gefährden eine höhere Lebenserwartung und geringere Kapitalmarktrenditendie langfristige Finanzierbarkeit der Beruflichen Vorsorge bei.
Anstatt an einzelnen Parametern zu schrauben wie die Schweiz wagt die Niederlande den Versuch, das System der Beruflichen Vorsorge als Ganzes auf solidere Füsse zu stellen. Der am letzten Mittwoch veröffentlichte Bericht der sogenannten Goudswaard Commissie enthält viele Aspekte über die es sich zu diskutieren auch in der Schweiz lohnen würde. Neben der wenig überraschenden Forderung, weniger ehrgeizige Leistungsziele anzustreben, sind dies insbesondere zwei Punkte:
1) Hohe nominale Leistungsversprechungen (= hoher Umwandlungssatz) beschränken die Möglichkeit, die Renten an die Inflation anzupassen. Viele Jahre ohne nennenswerte Inflation haben uns vergessen lassen, wie wichtig eine Indexierung an die Inflation sein kann. So bedeutet eine Inflation von jährlich 2% (was für die Schweizerische Nationalbank immerhin noch knapp Preisstabilität heisst) eine kalte Rentenkürzung um einen Drittel nach 20 Jahren Ruhestand. 20 Jahre entspricht der restlichen Lebenserwartung im Alter von 65.
Der Goudswaard Bericht schlägt vor, die „weichen Rechte“ (Indexierung an die Inflation) gegenüber „harten Rechten“ (Umwandlungssatz) stärker zu gewichten.
2) Berufliche Vorsorgesystem beinhalten eine Verteilung der systemischen Risikos (Finanzkrisen, Lebenserwartung) auf verschiedene Generationen. Es ist daher kein Zufall, dass die stark auf Risikoteilung basierenden Systeme in den Niederlanden und der Schweiz die Finanzkrise relativ gut überstanden haben. Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass die Risikoteilung zwischen den Generationen zu einer Umverteilung zu Lasten der Aktiven führt.
Der Goudswaard Bericht schlägt vor, die bis anhin unvollständigen Verträge über den Risikoausgleich zwischen den Generationen in vollständige Verträge umzuwandeln. Weniger technisch gesprochen hiesse dies beispielsweise, dass die Eigentumsrechte an den Überschüssen und Schwankungsreserven der Pensionskassen klar definiert würden. Oder dass bei Unterdeckung automatisch ein im Voraus definierter Sanierungsplan zur Anwendung kommt, an dem sich Aktive und Pensionierte beteiligen. Näheres findt sich in der Präsentation von Prof. Theo Nijman (Professor für Finance Tilburg University, Mitglied der Goudswaard Commissie) am Netspar Pension Workshop in Amsterdam.

 Wie bildet sich bei der Maus eine Hand? Solche Fragen untersucht Prof. Dagmar Iber von der ETHZ, auf dem Bild mit ihren “cobis” (computational biologists) im Rahmen ihrer Forschung zu
Wie bildet sich bei der Maus eine Hand? Solche Fragen untersucht Prof. Dagmar Iber von der ETHZ, auf dem Bild mit ihren “cobis” (computational biologists) im Rahmen ihrer Forschung zu