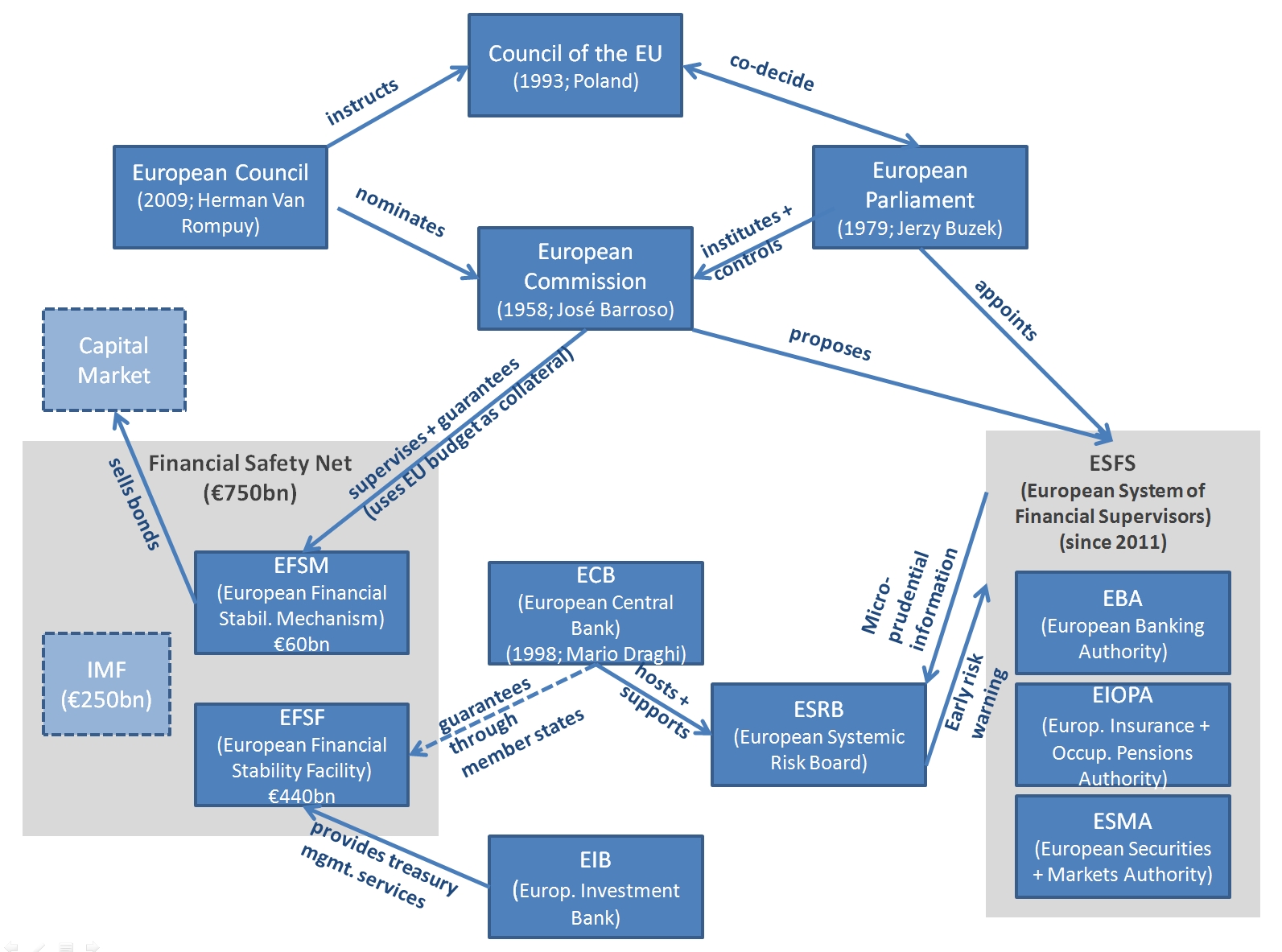Monika Bütler
Der Bundesrat hat beschlossen, die Pensionskassen zu ermächtigen, Umwandlungssätze in der beruflichen Vorsorge nach Risikoverhalten abzustufen. Normalgewichtige tragen mit ihrer Lebensweise massgeblich zur Explosion der Rentenkosten bei der AHV und den Pensionskassen bei. Dieses Risikoverhalten der Dünnen soll künftig durch eine Reduktion der BVG-Altersrenten um bis zu 15 Prozent kompensiert werden.
Natürlich stimmt diese Meldung nicht. Nicht ganz, respektive. Doch seit eine mehr als fragwürdige Studie einer 53% Mehrheit der Schweizer(innen) ein zu grosser Bauchumfang attestierte, geistert das Gespenst der risikogerechten Prämie in der Krankenversicherung wieder herum. Logisch zu Ende gedacht, müsste daher den (angeblich) Dicken nicht nur höhere Krankenkassenprämien in Rechnung gestellt werden. Nein, sie müssten im Gegenzug von der tieferen Lebenserwartung „profitieren“, das heisst für den kürzeren Ruhestand höhere Renten erhalten.
Risikogerechte Prämien in den obligatorischen Sozialversicherungen führen nicht nur zu bürokratischen Leerläufen sondern auch zu verteilungspolitische unerwünschten Resultaten.
Ärmere Menschen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu sein. Beim Gewicht kann noch mit «Selbstverschulden» argumentiert werden. Doch die Grenze zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Risikofaktoren ist fliessend. Ebenso wichtig scheint mir eine andere Auswirkung von immer komplizierteren Versicherungsverträgen. Die Teilzeit arbeitende Städterin, die regelmässig das Fitnessstudio aufsucht, wird eher Zeit und den Zugang zu relevanten Informationen haben, den für sie günstigsten Vertrag in der «risikogerechten» obligatorischen Krankenversicherung zu suchen, als die ebenfalls schlanke Bergbäuerin.
Die beiden kursiv gedruckten Paragraphen stammen (leicht abgeändert) aus einer NZZaS Kolumne von mir (ich habe mich damals schon über die Forderung nach risikogerechten Krankenkassenprämien für Raucher und Dicke geärgert). Der ganze Text kann hier nachgelesen werden.