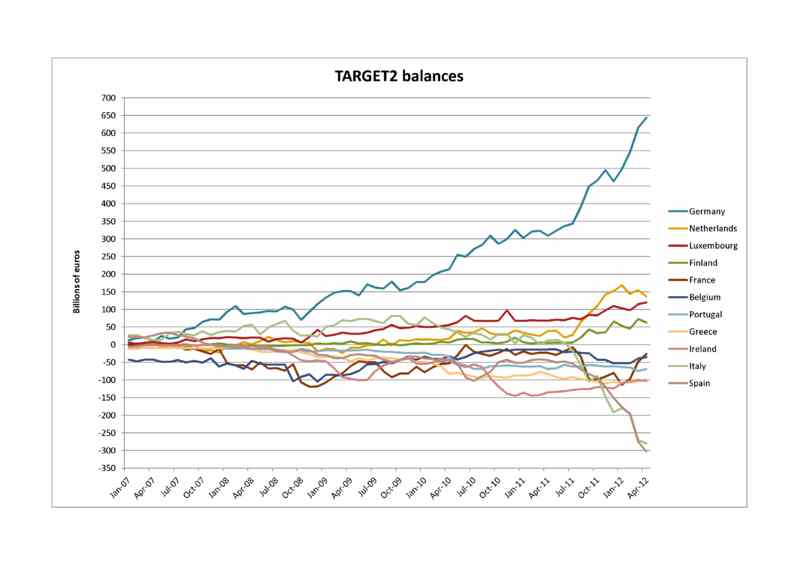Monika Bütler
NZZ am Sonntag, 15. Juli 2012 („Das Auswahlverfahren für Ärzte ist ein riesiger Blödsinn)
Zahnmedizin, meinte die Jahrgangsbeste einer aargauischen Kantonsschule nach der Maturafeier kürzlich auf die Frage nach ihrem Studienwunsch. Doch wisse sie natürlich nicht, ob sie die Prüfung bestehen würde. Gemeint war der sogenannte Eignungstest für medizinische Studiengänge (EMS), der unter den viel zu vielen Bewerbern die besten, pardon; die geeignetsten, auswählen soll.
Mit anderen Worten: Selbst die Allerbesten einer ohnehin schon kleinen Gruppe von Maturanden (im Aargau nicht einmal 20% eines Jahrgangs), müssen die Prüfung ablegen. Die ist, mit Verlaub, ein gigantischer Blödsinn. Der administrative und organisatorische Leerlauf – zu dem auch zählt, dass sich Tausende von Bewerbern wochenlang auf den Test vorbereiten – ist noch das wenigste. Richtig übel ist die Geringschätzung von engagierten, motivierten und offensichtlich ziemlich intelligenten jungen Menschen in einem Land mit einem grossen Ärztemangel.
Nun kann man natürlich argumentieren, dass eine 5.9 in der Matura noch lange nicht zu einer Medizinlaufbahn befähigt. Mir wäre allerdings auch keine Studie bekannt, die einen negativen Zusammenhang zwischen Note und einer Eignung für Medizin findet. In anderen Worten: mit 5.9 ist man vielleicht keine bessere Ärztin als jemand mit einer 4.0, aber kaum eine schlechtere. Intelligenz kann nie schaden. Der zuständige blutjunge Assistenzarzt hat seinerzeit das Leben unseres Jüngsten gerettet, nicht weil er eine hohe Sozialkompetenz hatte, sondern weil er blitzschnell die Symptome richtig einschätzte und entsprechend handelte.
Die am Eignungstest abgefragten Kompetenzen – unter anderen: Fakten lernen, Diagramme und Tabellen interpretieren, ein medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis, quantitative und formale Probleme lösen oder Texte verstehen – scheinen mir ziemlich deckungsgleich mit den an den Gymnasien während Jahren antrainierten Fähigkeiten. Sollte ich mich irren, müsste man die schweizerische Maturitätsausbildung dringend hinterfragen und reformieren.
Die Zielgenauigkeit des EMS zeigt sich auch darin, dass die HSG den Kandidaten für den HSG-Zulassungstest („kein Wissens-, sondern ein Eignungstest“) empfiehlt, sich mit dem EMS auf die Prüfung vorzubereiten. Entweder sucht die Medizin verkappte Betriebswirte oder die HSG verkappte Ärzte oder – viel plausibler – beide suchen einfach intelligente junge Menschen mit breiten Fähigkeiten. Eben genau das, wofür die Matura eigentlich stehen müsste.
Die Absurdität der Auslese ist kaum mehr zu überbieten. Der ganze Zirkus um die Gymiprüfung nach der 6. Klasse lässt glauben, es gehe darum, die Elite von den nicht ganz so Klugen fernzuhalten und den Ausgewählten die Ihnen zustehende hochqualifizierte Ausbildung zukommen zu lassen. Sechs staatliche Ausbildungs- und Selektionsjahre später traut der Staat dann selbst den Besten der Ausgewählten nicht mehr über den Weg und schickt sie zur Sicherheit nochmals zum Test.
Der Bedarf an Ärzten in der Schweiz wird so bei weitem nicht gedeckt. Das liegt allerdings nicht am Eignungstest, sondern an der begrenzten, seit Jahren konstanten Anzahl an Ausbildungsplätzen. Es gibt somit kein objektives, absolutes Eignungskriterium. Bei steigender Anzahl Kandidaten wird die Hürde einfach immer höher. Vor 10 Jahren schafften sie rund 90%, letztes Jahr waren es noch 34%.
Nicht so schlimm, es gibt ja genügend Mediziner im Ausland. Selbstverständlich habe ich nichts gegen ausländische Ärzte. Sie sind ein Segen für unser Land. Ein Jammer ist hingegen, dass wir die Lücke einer als überzählig ausgeschiedenen, aber geeigneten und motivierten Schweizerin oder Seconda später mit jemandem füllen müssen, der am selben Test ebenfalls „gescheitert“ wäre.
Die Jahrgangsbeste hat den EMS hoffentlich bestanden. Die Mühe, eine gute Maturaprüfung abzulegen, hätte sie sich dann sparen können.