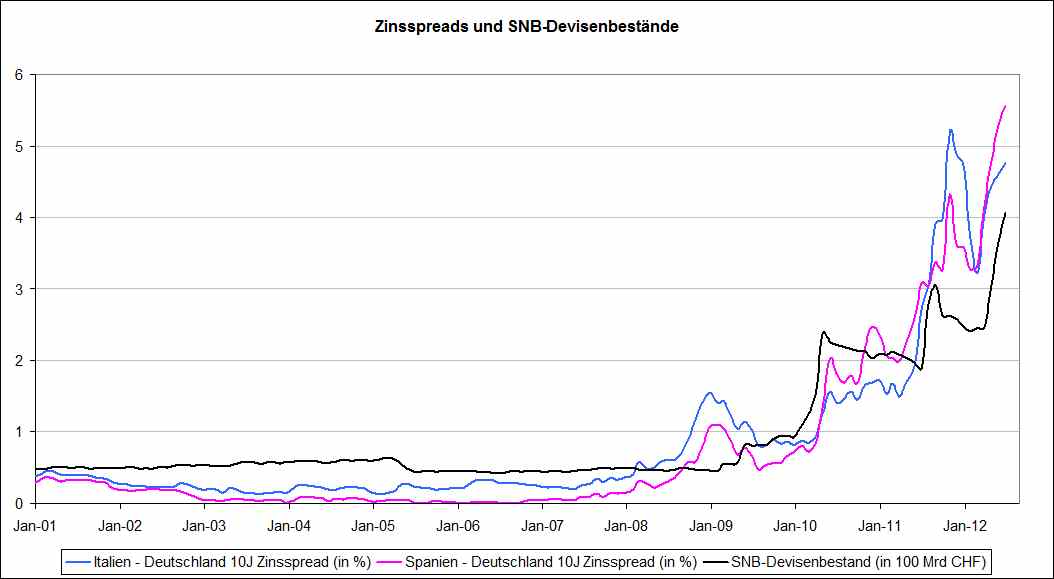von Monika Bütler
Aus aktuellem Anlass: Daniel Binswanger beklagt heute im Magazin, dass die Schweizer bloss fleissig, aber nicht produktiv seien. Doch das Konzept der Arbeitsproduktivität ist ein schlechtes Mass um den Erfolg einer Volkswirtschaft zu messen. Der untenstehende Text wurde unter dem Titel „Weshalb Französinnen effizienter Brote backen als wir“, in der NZZ am Sonntag, 28. Februar 2010, publiziert.
Alle Jahre wieder legt die OECD den Finger auf die Produktivität der Schweiz. Trotz einem Pro-Kopf-Einkommen, das kaum von einem anderen OECD-Mitglied erreicht werde, liege die Schweiz bei der Arbeitsproduktivität nur im Mittelfeld und habe in den letzten zehn Jahren weiter Terrain eingebüsst. Laut OECD liegt dies vor allem an der geringen Leistungsfähigkeit der abgeschirmten Sektoren im Binnenmarkt.
Letzteres wird wohl stimmen. Der eigenen Wahrnehmung entspricht es nicht in jedem Fall: Immerhin wurde unsere kaputte Heizung in Zürich jedes mal schnell repariert. Nicht so in den USA, wo wir als verzweifelte Kunden in endlose „your call is important to us“-Schlaufen abgeschoben wurden. Die Heizung funktionierte auch zwei Tage später noch nicht. Und als die schliesslich „geflickte“ Heizung nach weiteren zwei Tagen explodierte, erschien zwar nach einigen Stunden die Feuerwehr – der Brand war unter Opferung zweier Bettdecken längst gelöscht -, von der zuständigen Firma fehlte jede Spur.
Aber zurück zur Arbeitsproduktivität. Genau so wichtig wie die Leistungsfähigkeit der Binnenwirtschaft ist, dass hohe Einkommen und tiefere Produktivität oft Hand in Hand gehen. Nicht alle der 1415 jährlichen Arbeitsstunden pro Schweizer im Erwerbsalter (15-64) können gleich produktiv sein wie die 985 Stunden pro Franzosen.
Zur Illustration ein einfachen Beispiel. Nehmen wir an, alle Länder stellten nur ein Gut her, sagen wir Brot. Alle Länder hätten gleich leistungsfähige Arbeiternehmer. Aber auch die fleissigste Arbeiterin schafft nicht in jeder der 168 Stunden pro Woche gleich viel. Nehmen wir also an, sie backe in den ersten 30 Stunden 10 Brote pro Stunde. Ab der 31. Wochenstunde sinke ihre Arbeitsleistung auf 6 Brote pro Stunde.
Nun ist die wöchentliche Arbeitszeit in der Schweiz rund 42 Stunden, in Frankreich nur 35 Stunden. Eine Schweizerin bäckt somit im Durchschnitt 372 Brote pro Woche (wer es nachprüfen will: 30*10 Brote + 12*6 Brote), eine Französin 330 Brote pro Woche. In der Arbeitsproduktivität übertreffen uns daher die Franzosen mit 9.42 Broten pro Stunde (=330 Brote geteilt durch 35 Stunden) um volle 6.5 Prozent. Die französische Gesamtproduktion (und somit das Einkommen) bleibt dennoch 13% tiefer als die schweizerische.
Doch es gibt einen noch wichtigeren Grund, weshalb die Schweiz eine relativ geringe Arbeitsproduktivität bei gleichzeitig hohem Einkommen hat: Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern werden bei uns auch Menschen in den Arbeitsmarkt integriert, die aus verschiedenen Gründen eine tiefere Produktivität haben. Dies lässt sich an den vergleichsweise geringen Arbeitslosenzahlen und den hohen Erwerbsquoten in allen Bevölkerungsgruppen zeigen. So arbeiten in der Schweiz rund 55% der 60-64 jährigen, in Frankreich sind es lediglich 15%.
Je mehr nicht ganz so produktive Menschen am Erwerbsleben teilnehmen, desto tiefer liegt die durchschnittliche Arbeitsproduktivität des Landes. Umso höher ist dafür das Einkommen. Liessen wir nur Roger Federer arbeiten, hätten wir eine viel höhere Arbeitsproduktivität. Zum Wohlstand der Schweiz trägt er dennoch weniger bei als die gescholtene Binnenwirtschaft.
Gerade die Diskussion um die Armutsbekämpfung zeigt, dass neben der materiellen Absicherung auch das Gefühl des „Gebrauchtwerdens“ für die in der globalisierten Welt nicht ganz so produktiven Menschen wichtig ist. Eine tiefere Arbeitsproduktivität ist somit ein Preis, den wir für eine bessere soziale Integration zahlen.
Vielleicht sogar für eine höhere Lebensqualität: Auf jeden Fall geniesse ich meine sorgfältig (= wenig produktiv) in der Briefkasten gelegte NZZ am Sonntag mehr als die bei grosser Geschwindigkeit hoch produktiv aus dem Auto geworfene Zeitung in den USA. Dort musste ich oft zuerst die Salatsauce aus dem vom Aufprall geplatzten Warenmuster von der Kolumne abkratzen.

 Seit Jahren wechseln sich Presseberichte über „Grüselbeizen“ (z.B. hier im
Seit Jahren wechseln sich Presseberichte über „Grüselbeizen“ (z.B. hier im  Am 5./6. September findet an der Universität Zurich das 30. SUERF Colloquium statt. Es trägt den Titel: „States, Banks, and the Financing of the Economy“.
Am 5./6. September findet an der Universität Zurich das 30. SUERF Colloquium statt. Es trägt den Titel: „States, Banks, and the Financing of the Economy“.