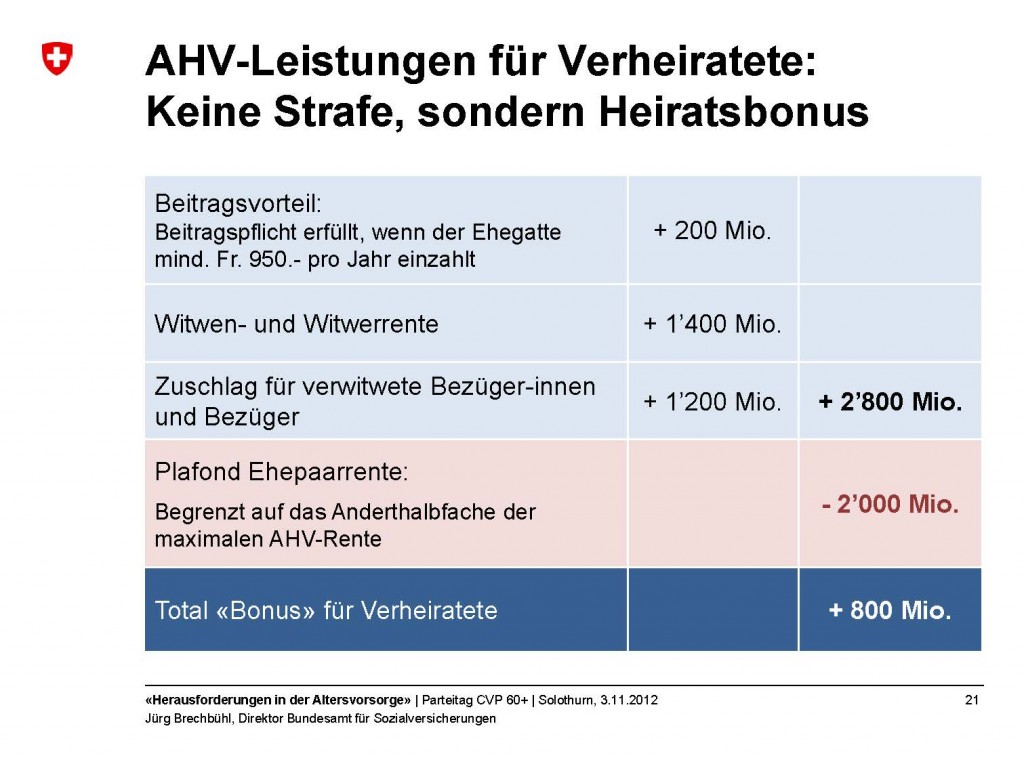Monika Bütler
Aus aktuellem Anlass (gravierende Budgetprobleme in denjenigen Kantonen, welche ihre Steuern massiv gesenkt hatten) hier eine alte Kolumne in der NZZ am Sonntag (11. September 2011).
Die Lage der öffentlichen Finanzen in der Schweiz ist schlechter, als es scheint
Verkehrte Welt! In verschiedenen Ländern fordern reiche Bürger höhere Steuern. Die Regierungen? Wollen nicht. Dabei täten sie gut daran, die Argumente für etwas mehr Steuern auf sehr hohen Einkommen und Vermögen zu prüfen. Auch in der Schweiz.
Noch vor wenigen Jahren galten Steuersenkungen als Gratisaktion: Dank mehr Investitionen und höherer Produktivität würden sich die Steuersenkungen selbst finanzieren. Diese Hoffnungen wurden enttäuscht. Neben Gewinnen für die Bessergestellten blieben Defizite der öffentlichen Hand. Eigentlich müssten heute mindestens ein Teil der Steuersenkungen rückgängig gemacht werden. Doch fast alle (Politiker) scheuen nur schon die Diskussion darüber. Dabei steht es um die öffentlichen Finanzen schlechter, als es scheint. In den offiziellen Zahlen sind die impliziten Schulden aufgrund der alternden Bevölkerung noch gar nicht eingerechnet.
Einem wohl länger anhaltenden Rückgang der Steuereinnahmen zum Trotz: Lieber werden der Polizei und den Spitälern die dringend notwendigen Stellen vorenthalten und die Infrastruktur vernachlässigt als Steuern angehoben. Doch solche Sparübungen bringen gesamtwirtschaftlich wenig. Aber sie treffen die weniger Verdienenden und gefährden den Zusammenhalt der Bevölkerung, letztlich die Grundlage einer erfolgreichen Wirtschaft. Es erstaunt nicht, dass die Halbierung der Vermögenssteuern im Kanton Zürich wuchtig verworfen wurde.
Auch viele Reichen haben erkannt, worin der Erfolg westlicher Volkswirtschaften besteht. Ungleichheiten werden akzeptiert, solange die Glücklicheren ihren Teil am Gemeinwohl leisten. Eigentum verpflichtet, heisst es sogar explizit im deutschen Grundgesetz. Ganz besonders stark ist der stillschweigende Gesellschaftsvertrag in den USA. Das erklärt einen Teil der Ungeduld, mit der die USA von der Schweiz einfordern, was Steuerflüchtige der amerikanischen Gesellschaft finanziell und ideell entzogen haben.
Die Angst der Politiker und vieler Bürger selbst vor einer geringfügig stärkeren Besteuerung sehr hoher Einkommen und Vermögen ist dennoch verständlich. Denn die Linke fordert Steuererhöhungen, nicht um Schulden und Defizite abzubauen, sondern um Mehrausgaben zu finanzieren, von frühzeitiger Pensionierung bis zu Subventionen für alles und (fast) jeden. Wer gegen solche Ausgaben ist, kämpft logischerweise gegen Steuererhöhungen.
Dass sich die Kantone scheuen, Steuern für sehr hohe Einkommen anzuheben, ist ebenfalls nicht verwunderlich. Mit dem neuen Finanzausgleich (NFA) wurde einem gut funktionierenden Steuerwettbewerb zwar eine solide Grundlage verpasst. Dennoch ist es für die Kantone noch immer „günstiger“, sehr Reiche anzuziehen als den wirtschaftlich oft viel stärker engagierten Mittelstand und das Unternehmertum. Selbst wenn die Diskussion in erster Linie auf Bundesebene stattfinden muss: Auch die Kantone werden nicht darum herum kommen, ihre Einnahmen den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen, wenn sie nicht mit einem Schuldenberg enden wollen.
Mindestens eines hat die Schweiz anderen Ländern voraus. Die Diskussion über eine Ausgestaltung des Steuersystems ist noch nicht polarisiert. Wir haben keine Tea- oder Kafi-Lutz-Party. Dafür einen funktionierenden und effizienten Staat, in welchem sich der Grossteil der Bevölkerung — arm und reich — noch dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt. Für die sehr Reichen könnten sich etwas höhere Steuern – solange das Geld nicht gleich wieder ausgegeben wird – sogar lohnen. Auf die Dauer sind gesunde Staatsfinanzen der beste Schutz vor Vermögens- und Einkommensverlusten.
Gelingen müsste deshalb ein „historischer Kompromiss“: etwas höhere Steuern für die obersten Einkommen und Vermögen, aber ohne zusätzliche Ausgaben. Steuerwillige Reiche und haushälterische Linke vereinigt Euch!