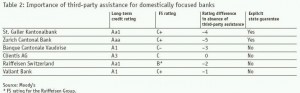Die Wahlresultate in Frankreich und Griechenland, so meldet beispielsweise der Tagesanzeiger seien ein Votum „gegen den rigiden Sparkurs Europas, wie ihn Deutschland seinen Partnern aufgezwungen hat“. Wofür aber stimmt man, wenn man gegen das Sparen stimmt?
Ein Staat kann mit seinen Schulden auf vier [korr.] Arten umgehen:
- sie mit eigenem (gespartem) Geld zurückzahlen,
- sie mit neu geborgtem Geld zurückzahlen (refinanzieren),
- sie mit neu gedrucktem Geld (d.h. real nur teilweise) „zurückzahlen“,
- sie nicht zurückzahlen (Bankrott erklären).
Nun ist also Variante 1 politisch „out“. Variante 2 geht aber nur, wenn jemand neues Geld zur Verfügung stellt. Wer soll aber Geld geben, wenn der Schuldner das Sparen ausdrücklich ablehnt. Also ist Variante 2 auch out. Variante 3 ist im europäischen Verbund auch out, da die einzelnen Staaten kein Geld mehr drucken können (für die EZB lassen wir für einmal die Unschuldsvermutung gelten). Damit bleibt als einzige die Variante 4, der offene Staatsbankrott.
Man wird ja wohl noch für den Staatsbankrott stimmen dürfen!? Gewiss, nur hätte ich dann wohl nicht noch den culot, die Finanzmärkte und die Deutschen anzuschwärzen, wenn sie die Botschaft verstehen und nichts mehr geben.
P.S.: Die Baron-von-Münchhausen-Variante, wonach der bankrotte Staat mit noch mehr Ausgaben jenes Wirtschaftswachstum erzeugt, das dank zusätzlicher Steuern die Ausgaben finanziert, lasse ich dort, wo sie hingehört — im Märchenbuch.