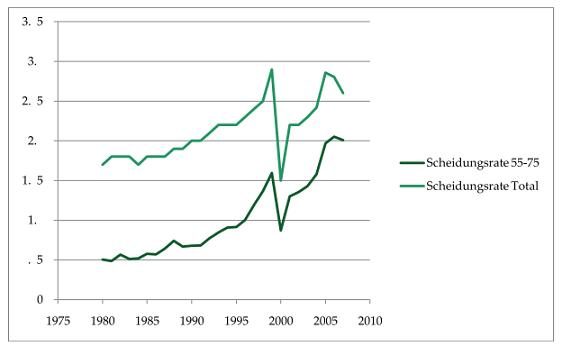Wer zu einem kleinen Lohn arbeitet, hat oft weniger verfügbares Einkommen als ein Sozialhilfebezüger. In vielen Kantonen gibt es substantielle Schwelleneffekte beim Ausstieg aus der Sozialhilfe. Genau so wie dem Arbeiter mit bescheidenem Lohn, geht es einer Rentnerin mit einer kleinen BVG Rente. Unter Umständen bleibt ihr weniger als ihrer Kollegin, deren AHV Rente durch Ergänzungsleistungen aufgebessert wird. Grund ist in beiden Fällen, dass Arbeitseinkommen und Rente (aufgeschobenes Arbeitseinkommen sozusagen) besteuert werden, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe jedoch nicht.
Die steuerliche Ungleichbehandlung lässt sich nicht rechtfertigen. Sie führt zudem zu krassen Fehlanreizen. Es lohnt sich im Falle von Sozialhilfe nicht, zu arbeiten. Die Rentnerin fährt besser, wenn sie sich ihr Alterskapital aus der beruflichen Vorsorge auszahlen lässt. Wenn es aufgebraucht ist, kann sie Ergänzungsleistungen beziehen (Mehr dazu hier).
Bedarfsleistungen dürften steuerlich nicht mehr privilegiert werden. Die Frage ist, wie dies in der Praxis umzusetzen wäre. Ein erster Vorschlag wäre, alle Einkommen – also insbesondere auch Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen genau gleich wie Erwerbseinkommen zu besteuern. In diesem Fall bleibt den Bedürftigen weniger. Gleichzeitig käme es wohl unweigerlich zu einem Druck, die Bedarfsleistungen als Kompensation zu erhöhen. Die zweite Idee ist eine weitgehende Befreiung des Existenzminimums von den Einkommenssteuern.
Gegen den zweiten Vorschlag – eine Steuerbefreiung des Existenzminimums – regt sich vor allem Widerstand aus bürgerlichen Kreisen. Auch das Bundesgericht meinte vor einiger Zeit: Aus Art. 4 BV (Existenzsicherung) könne nicht abgeleitet werden, dass „ein bestimmter Betrag in der Höhe eines irgendwie definierten Existenzminimums von vornherein steuerfrei belassen werden könnte.“ Die Besteuerung aller Einwohner sei wichtig, damit sich auch wirklich alle bewusst seien, dass die Leistungen des Staates nicht gratis zu haben seien. Oder wie es das Bundesgericht ausdrückt: „Aus dem aus Art. 4 BV hergeleiteten Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung kann auch gefolgert werden, dass alle Einwohner entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einen – wenn auch unter Umständen bloss symbolischen – Beitrag an die staatlichen Lasten zu leisten haben.“
Ich glaube dennoch, dass die weitgehende Steuerbefreiung des Existenzminimums aus folgenden Gründen richtig wäre:
1) Bereits heute beteiligen sich über die Mehrwertsteuer und Gebühren auch die Ärmeren an den staatlichen Lasten.
2) Das Argument, eine Einkommenssteuer auf geringen Einkommen erhöhe das Bewusstsein über die Kosten der staatlichen Leistungen, kaufe ich nicht. Es mag sein, dass den meisten die Beteiligung an den Kosten via Mehrwertsteuern und Gebühren nicht bewusst ist. Viel offensichtlicher ist dies, wenn man eine Steuerrechnung erhält, die aufs Mal bezahlt werden muss. Ob es allerdings gescheiter ist, Einkommensteuern auch auf sehr kleinen Einkommen zu erheben und diese dann in Form von Subventionen wieder zurückzuerstatten, sei dahingestellt. Das Bewusstsein, dass die staatlichen Leistungen etwas kosten, wächst so kaum. Meiner Meinung leidet dadurch eher das Ansehen des Staates.
3) Eine weitgehende Steuerbefreiung des Existenzminimums erzeugt weniger negative Arbeits- und Sparanreize. Das Dickicht von Steuern und einkommensabhängigen Subventionen bestraft heute diejenigen am meisten, die sich aus eigener Kraft aus der Armut befreien wollen.
PS1: Nationalrat Paul Rechsteiner (SP St. Gallen) hat mich mit seiner Frage zur Steuerbefreiung des Existenzminimums (anlässlich einer Anhörung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates) zu diesem Batz-Eintrag angeregt.
PS2: Ein herzliches Dankeschön an meinen Mitarbeiter Lukas Schwank, der diesen Beitrag kritisch durchgelesen hat – er hätte wohl differenzierter argumentiert.