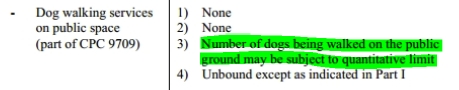Monika Bütler
Die Schweiz soll nicht wie Hong Kong oder Singapur werden. Ein griffiger und einleuchtender Slogan der Ecopop Befürworter. Nur leider falsch.
Natürlich möchten die meisten von uns (mich eingeschlossen) lieber in der Schweiz als in Hong Kong leben. Nur ist der Vergleich der beiden asiatischen Städte mit der Schweiz unfair und berücksichtigt weder die Geschichte noch das wirtschaftliche, geopolitische und klimatische Umfeld der unterschiedlichen Gegenden. Das richtige Gegenstück im Vergleich mit Hong Kong oder Singapur wäre Hong Kong/Singapur ohne „Dichtestress“. Ein einfacher Blick über die Grenzen der beiden Städte zeigt: Die Wahl ist eben nicht zwischen 15 Quadratmetern/Person im Dichtestress und plus minus gleichem Lebensstandard auf 45 Quadratmetern/Person ohne Dichte. Sondern
- zwischen 15 Quadratmetern/Person in guten hygienischen und relativ umweltfreundlichen Verhältnissen, mit Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Arbeitsstellen und guten Schulen, welche den Kindern die Tür zur Welt offen halten.
- und 15 Quadratmetern/Person in prekären Behausungen ohne ÖV, ohne adäquate Arbeitsplätze mit beschränkter medizinischer Versorgung und qualitativ schlechten Schulen. Und ja: mit Dreck und Umweltbelastungen.
Kein Bewohner Singapurs würde mit einem Bewohner ännet der Johor Strait tauschen wollen. Umgekehrt hingegen schon.
Da ich Singapur viel besser kenne, hier etwas Hintergrund zu Singapur. Nach der Unabhängigkeit Singapurs von Grossbritannien schloss sich die Stadt nach dem 1962 Merger Referendum der Federation of Malaya an (im Wesentlichen Malaysia, Sarawak und Nord Borneo). Die Gründe: Grösse des Landes, Knappheit an Wasser, Land und natürlichen Ressourcen. Die zwei Jahre in Union mit Malaysia waren allerdings geprägt von Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten. So wollte Singapur eine Gleichbehandlung aller Rassen, Sprachen und Religionen, was vom Rest der Federation abgelehnt wurde. 1965 wurde Singapur aus der Federation geworfen, ohne in der Frage überhaupt angehört zu werden.
Interessanterweise wurde Singapur ein Stadtstaat contre coeur. Das heutige Singapur ist somit eine Antwort auf die Herausforderungen, welche dem neuen Staat mit dem knappen Land und der Abwesenheit von natürlichen Ressourcen erwuchsen. Wie auch die Schweiz setzte Singapur in der Folge auf eine wirtschaftliche Entwicklung, die auf Unternehmertum, technologischem Fortschritt und Ausbildung basierte. Und auf eine gewisse Einwanderung, welche den Fortschritt erst ermöglichte. Singapur hat heute eine durchaus restriktive Einwanderungspolitik; diese berücksichtigt jedoch die Bedürfnisse der Bevölkerung insbesondere nach Arbeitskräften, die im Lande selber fehlen. Mit einer Abschottung wäre der Vorsprung Singapurs gegenüber seinen Nachbarn schnell weg. Immigration ist eben nicht nur Folge der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch teilweise deren Ursache.
So unterschiedlich Hong Kong oder Singapur und die Schweiz auch sein mögen. Auch bei uns muss der breite Wohlstand in den ländlichen Gegenden zuerst erwirtschaftet werden. In den viel dichter bevölkerten Städten nämlich oder den nicht so idyllischen Industriezonen. Die Umsetzung eines weiteren Slogans der Ecopop Befürworter – die Arbeitsplätze zu den Bewohnern bringen und nicht umgekehrt – würde nie und nimmer die Wertschöpfung bringen, die nötig wäre, um unseren Lebensstandard zu halten.
PS: Die momentane Popularität von Ecopop hat allerdings nicht viel mit deren Argumenten zu tun als viel mehr dem Schweigen und der Untätigkeit der Politik in den Diskussionen um die Folgen Personenfreizügigkeit (siehe meinen früheren Beitrag). Niemand erklärte den besorgten Bürgern, woher die (nicht so zahlreichen) Ausländer kommen, die wirklich Probleme machen (nämlich mehrheitlich nicht aus der EU). Auf griffige – auch während der Personenfreizügigkeit mögliche – Massnahmen gegen eine Einwanderung in den Sozialstaat (Rückführungen, Einschränkungen des Familiennachzuges, Straffung des Asylwesens) wurde verzichtet. Und wir warten bis heute auf eine vernünftige Einwanderungspolitik für Bürger aus Drittstaaten. Statt den Zug sanft zu bremsen, schielte die Politik viel zu lange auf die Notbremse (in Form der Ventilklausel). Die Notbremse zogen am 9. Februar andere. Im Tunnel.