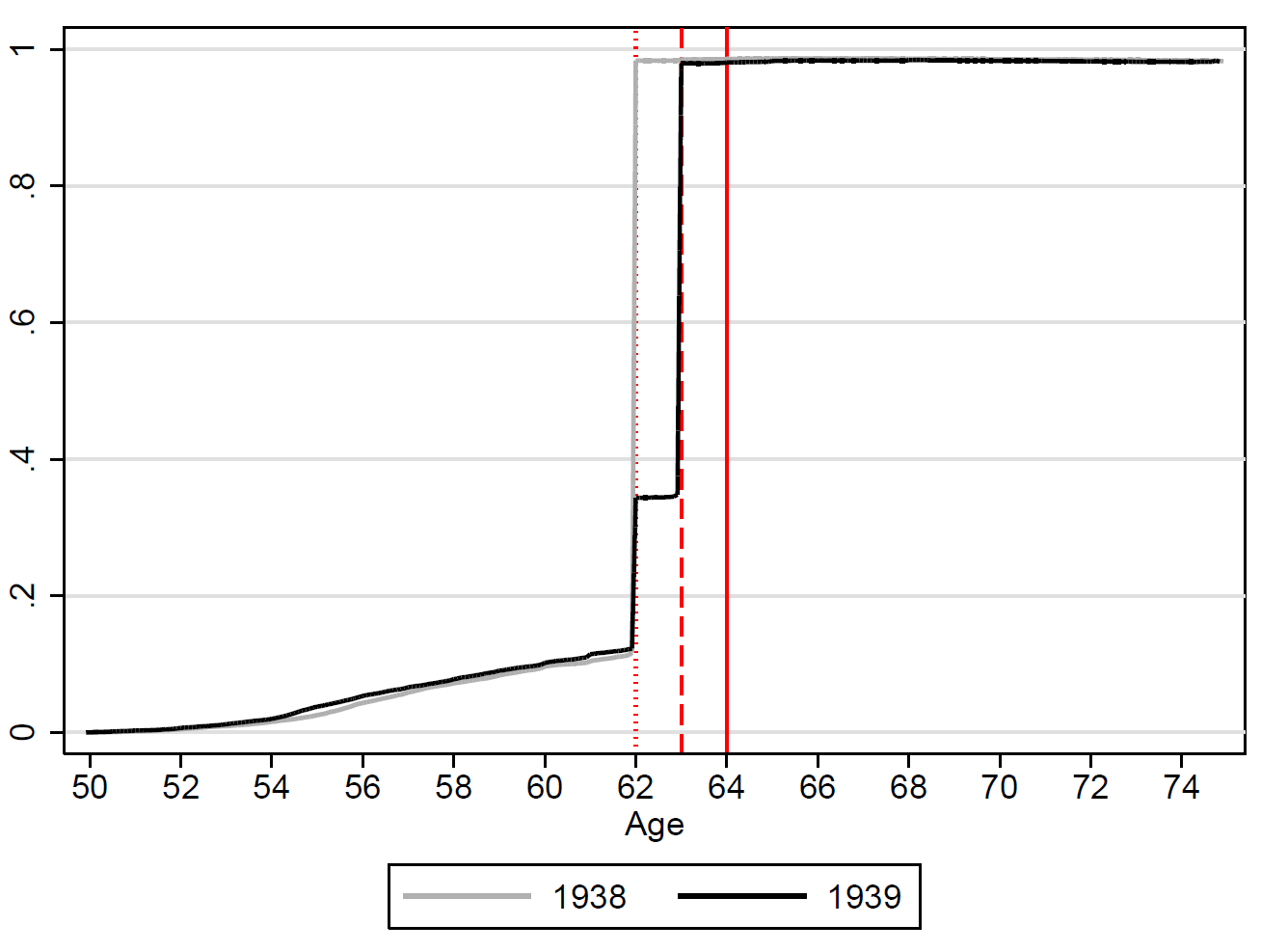Urs Birchler
Jetzt kommt’s knüppeldick. Heute ist das Buch Das Ende der Banken: Warum wir sie nicht brauchen (basierend auf einer englischen Version von 2014) erschienen. Der fiktive Autor Jonathan McMillan steht für ein Duo bestehend aus dem NZZ-Wirtschaftsredaktor Jürg Müller und einem anonymen Investmentbanker. Die NZZ hat bereits vor zwei Wochen als Primeur eine Besprechung durch Tobias Straumann abgedruckt.
Die Autoren gehen aufs Ganze. Sie wollen verbieten, dass finanzielle Anlagen durch Schulden finanziert werden. Beispiel: Wer einen Hypothekarkredit gewähren will, darf diesen nicht mit Spareinlagen oder Kassenobligationen finanzieren. Im Klartext: Die Banktätigkeit wird verboten. Finanzielle Investitionen dürfen nur noch durch Eigenmittel finanziert werden. Eine „Bank“ bräuchte also hundert Prozent Eigenmittel (ausser für irgendwelche nicht-finanziellen Anlagen wie z.B. ihr Gebäude), wodurch sie zu einem Anlagefonds würde. Als zweite — „systemische“ — Sicherung müsste eine Unternehmung stets solvent sein, d.h. ein bisschen mehr Vermögen haben als Schulden.
Während die Vollgeldinitiative verlangt, dass Banken Kredite nicht mit Einlagen finanzieren („kein Geld schöpfen“), gehen die Autoren einen Schritt weiter und verbieten die Kreditfinanzierung mit Schulden überhaupt, egal ob mit Lohnkonti oder zehnjährigen Obligationen. Grob gesprochen: Die Vollgeldinitiative will die Banken in ihrer Fähigkeit zur Geldschöpfung kastrieren; die beiden Autoren von Das Ende der Banken wollen die Banken umbringen.
Gemein ist beiden Vorschlägen die „zweite Säule“: Die Geldschöpfung — die nur noch durch die Nationalbank erfolgen kann — soll nicht in Form eines Ankaufs von Vermögen (der Währungsreserven) erfolgen. Die Autoren sind auch hier radikaler als die Vollgeldinitiative: Neu geschaffenes Geld soll die Nationalbank an die Bürgerinnen und Bürger überweisen (die Vollgeldinitiative erlaubt auch eine Auszahlung an Bund und Kantone). Der Vorschlag beinhaltet also ein bedingungsloses Einkommen (wie die Autoren betonen: nicht Grundeinkommen, da die jährliche Geldschöpfung der SNB zu einem solchen nicht ausreicht). Und damit niemand auf dem Geld sitzen bleibt, kommt eine Liquiditätsprämie (gemeint: -steuer) dazu; Bargeld, das man einer solchen Besteuerung zu leicht entziehen könnte, wird abgeschafft.
Die Autoren versprechen sich (und den Leserinen und Lesern) einiges: Ein Ende von Finanzkrisen; Wegfall der (unbestritten) komplizierten Bankenregulierung; der impliziten Staatsgarantie für Banken und daher Wegfall des moral hazard im Bankenbereich — kurz: „Stabilität, Produktivität und Verteilungsgerechtigkeit“. Ein (zu) schöne neue Welt?
Die Autoren sind zu loben für eine überaus lesbare, flüssig geschriebene Einführung in die ökonomische Rolle der Banken. Die Argumentation wirkt auch selten propagandistisch (ausser: „Unser Vorschlag ist einzigartig, weil er das Digitalzeitalter mit offenen Armen begrüsst“). Ich habe auch keine Behauptungen entdeckt, die mir geradewegs falsch vorkamen. Die Argumentation wirkt geradlinig und überzeugt — fast. Ihre Stärke ist nämlich gleichzeitig ihre grösste Schwäche: Gegenargumente werden gar nicht erwähnt, geschweige denn geprüft.
Beispiel 1: Eine Bankenverbot dürfte wohl mit Kosten verbunden sein. Banken sind nicht nur eine (gelegentliche) Quelle von Krisen, sie haben auch über Jahrhunderte die wirtschaftliche Entwicklung begleitet und unterstützt. Ob dies im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr der Fall sein soll oder aber noch effizienter stattfinden wird, scheint mir offen. Die Autoren beklagen denn auch, dass die Fintech-Pioniere zunehmend mit den Banken kooperieren oder verschmelzen.
Beispiel 2: Wenn die Nationalbank Geld direkt an die Bürgerinnen und Bürger verschenkt, mögen sich diese freuen. Wie aber kann die SNB den Geldumlauf wieder reduzieren, sollte dies notwendig sein? Sie hat zwar einen Helikopter, aus dem sie Geld abwerfen kann, aber keinen Staubsauger, mit dem sie es wieder zurückholen kann. Eine Geldpolitik, die Wechselkursschwankungen abfedern kann, würde als auch gleich abgeschafft. Da klingt das Lippenbekenntnis zugunsten einer „unabhängigen Geldpolitik“ etwas hohl.
Und wetten, dass wir mit der Notwendigkeit „Eigenmittel“ und „Finanzielle Anlagen“ zu definieren, rasch wieder in der bösen alten Welt der Detailregulierung landen würden?
Fazit: Das Ende der Banken propagiert eine Rosskur, die ohne klinische Tests und ohne Packungsbeilage zu den Nebenwirkungen daherkommt. Tobias Straumann dürfte richtig prognostiziert haben, dass „die Idee kaum auf ungeteilte Zustimmung stossen wird“.