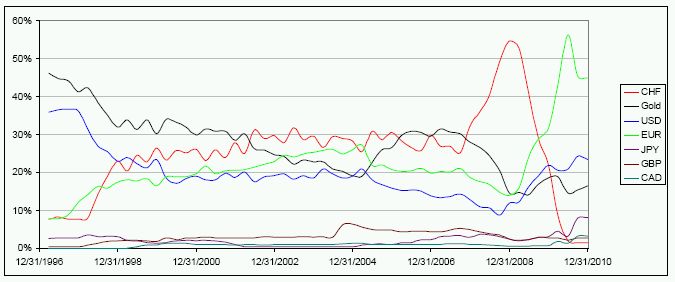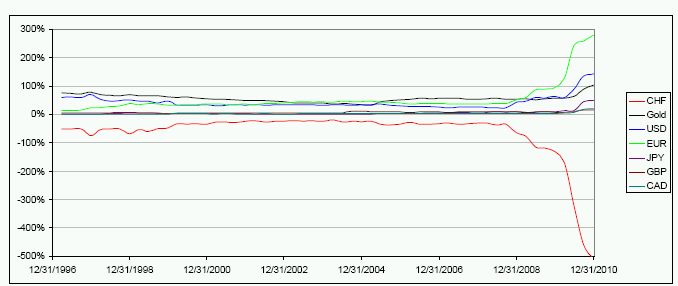In der EU-Bürokratie scheinen einige Sicherungen durchgebrannt. Die Rating-Agenturen sollen als Sündenböcke geschlachtet werden. Drum hier in aller Schnelle ein paar Leitlinien, in der eitlen Hoffnung, noch zur Entspannung beitragen zu können.
- Rating-Agenturen produzieren Information, d.h. ein hochgradig kopierbares Gut. Der Verkauf an Investoren ist daher ein fragiles Business-Modell (Musik-Industrie fragen). Moody’s verkaufte ab 1909 ihre Railway Ratings als dickes Buch an die Abonnenten. Als der Fotokopierer aufkam, war’s vorbei. Als Lückenbüsser mussten die Emittenten der gerateten Papiere hinhalten. Aufforderungen, „back to the roots“ (US-Senator Schumer) zu gehen, und Ratings an die Investoren zu verkaufen, mögen bei kleinen Anbietern funktionieren. Bei grossen wird’s schwierig. (Auch batz.ch kann sich leider nicht über seine Leser finanzieren). Das Problem ist in der Ökonomie seit langem als „Leuchtturmproblem“ bekannt.
- Die Finanzierung via Emittenten ist nicht besonders ergiebig, wenn man sie in Promillen der gerateten Papiere berechnet. Die Agenturen verdienen wenige Basispunkte (Hundertstelprozente) der emittierten Volumina. Eine Super-Informationsleistung ist daher gar nicht zu erwarten.
- Schon diese beiden einfachen informationsökonomischen Überlegungen führen zum Schluss: Vorsicht mit Ratings! Die sind fast immer schlechter, als sie eigentlich sein sollten. Genau wie das Fernsehprogramm. Die zahlreichen Gesetzgeber und Behörden, die Ratings in ihrem Vorschriften verwenden, müssen das damit verbundene Risiko daher auch selber verantworten. Genau wie jemand, der behauptet, Fernsehen habe ihn blöd gemacht.
- Die Ratingagenturen haben sich selber auf die schiefe Ebene begeben, indem sie begannen, die Schuldnerbeurteilung zu vermischen mit Beratung (z.B. wie man ein besseres Rating bekommt). Wenn der Schüler zur Lehrerin geht mit der Frage: „Wie kann ich bessere Noten erreichen?“, ist eine Antwort der Lehrerin noch nicht anstössig. Wenn sie dann aber entgeltliche Nachhilfestunden anbietet, wirds schräg. Dito bei Moody’s, S&P oder Fitch.
- Eine Ratingänderung einer grossen Agentur ist im Jargon der Informationsökonomie ein „öffentliches Signal“. Das heisst: Alle haben es gesehen und — noch wichtiger — alle wissen, dass alle wissen, etc. …, dass es alle gesehen haben. Das Signal ist sogenannt „common knowledge“. Damit entfaltet es eine Hebelwirkung: Investoren, die ein privates Gefühl haben und dem öffentlich sichtbaren Signal ausgesetzt sind, tendieren dazu, letzteres in ihren Entscheidungen überzubewerten (schön gezeigt im Artikel von Morris und Shin (AER 2002). Dies gilt besonders dort, wo es wichtig ist, mit seinen Entscheidungen nicht nur absolut richtig zu liegen, sondern auch relativ zu den andern (Konformismus). Genau die ist an der Börse der Fall: Wer keinen unendlichen Schnauf hat, darf nicht gegen die Masse spekulieren. Öffentliche Signale können daher kurfristig orientierte Investoren „gleichschalten“. Nicht der Fehler der Rating-Agenturen.
- Ratings können in konformistischer Umgebung zu selbsterfüllenden Prophezeihungen werden. Wenn ich ein AAA bekomme, erhalte ich Kredit günstig. Wenn ich auf D gesetzt werde, muss ich so hohe Zinsen zahlen, dass ich tatsächlich bankrott bin. Solche selbsterfüllenden Prognosen (Ökonomen sprechen von multiplen Gleichgewichten) sind möglich auf den Devisenmärkten: Ein einzelner Spekulant bringt den Franken nicht in den Keller; alle zusammen schon. Ebenfalls gefürchtet sind selbsterfüllende Prognosen im Bankenbereich (Bank Run).
- Die Rating-Agenturen sind nicht schuld an den europäischen Schulden. Vielleicht ein bisschen, weil sie gute und beste Ratings vergeben haben, obwohl die Maastricht-Kriterien von den Mitgliedsländern förmlich verhöhnt wurden. Aber des Geld geborgt haben die Staaten selbst. Und die Ratingagenturen zerstören Europa nicht. Die Überschuldung Griechenlands wäre auch mit einem AAA-Rating irgendwann aufgeflogen. Wenn man die Rating-Agenturen totschlägt, sind im übrigen auch keine Gütesiegel mehr erhältlich.
- Wunschdenken dürfte die Idee sein, von den Staaten ins Leben gerufene Rating-Agenturen wären unabhängiger als die bestehenden, von den Emittenten bezahlten Agenturen. Genau dann, wenn die Ratings den staatlichen Schudnern nicht passen, setzt der grosse Rachefeldzug ein, wie verschiedene Exponent(inn)en der EU-Bürokratie gegenwärtig demonstrieren.
- Eine nicht von den Emittenten finanzierte Ratingagentur wäre grundsätzlich möglich, falls jemand die Finanzierung übernimt. Vielleicht wird sich in der Finanzindustrie ein „Club“ bilden, der eine Finanzierung übernimmt. Oder aber eine internationale „Billag“ müsste das Recht haben, Gebühren einzutreiben, bei denen, die sie für Benutzer der Ratings hält.
Kurz: Die gegenwärtige Hatz gegen Rating-Agenturen, genauso wie das frühere blinde Vertrauen in die Ratings, beruhen auf weitgehender Unkenntnis der informationsökonomischen Hintergründe. Warum nicht in der Sommerpause unser Buch Information Economics lesen? Was? Liebesgeschichte? — Ist drin.