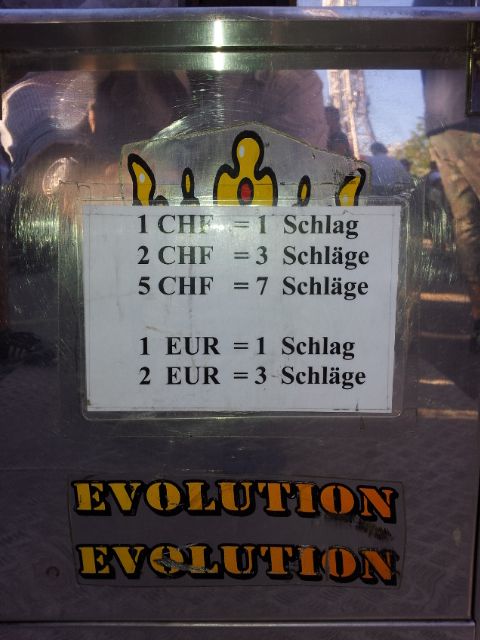Urs Birchler
Mit der Zuspitzung der Italien-Krise steigt auch wieder das Interesse an den Ausständen der Schweizer Banken gegenüber Italien. Dazu gibt es zwei Statistiken, jene der BIZ und jene der SNB.
Journalisten nehmen gerne jene der BIZ, gehen dabei aber fehl. Die BIZ-Statisik behandelt nämlich Banken nach ihrem Domizil. Konkret: Hat die Filiale einer italienischen Bank in London Schulden gegenüber einer Schweizer Bank, so zählt dies die BIZ als Guthaben der Schweizer Bank gegenüber dem Vereinigten Königreich. Die BIZ ist allerdings nicht etwa blöd; ihre Statistik dient der Berechnung von internationalen Zahlungsbeziehungen, nicht der Messung von Bankrisiken.
Die Nationalbank hingegen verwendet in ihrer Jahresstatistik das Unternehmensprinzip. Die ausländische Filiale (z.B. CS London) gilt dabei als Teil der Unternehmung (CS), was sie risikomässig auch ist (anders als eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft). Nach dieser Statistik betrugen die Ausstände der Schweizer Banken gegenüber Italien (in Mrd. Fr.) per Ende 2010:
- 7,7 insgesamt, davon 2,2 gegenüber Banken (bei jeweils ungefähr doppelt so hohen Verbindlichkeiten)
- 0,29% der Bilanzsumme, bzw. 5,1% der eigenen Mittel.
Fazit 1: Die Schweizer Banken gehen wegen Italien allein nicht unter.
Fazit 2: Die richtige Statistik verwenden (wir haben schon früher darauf aufmerksam gemacht, aber nicht mit vollem Erfolg).