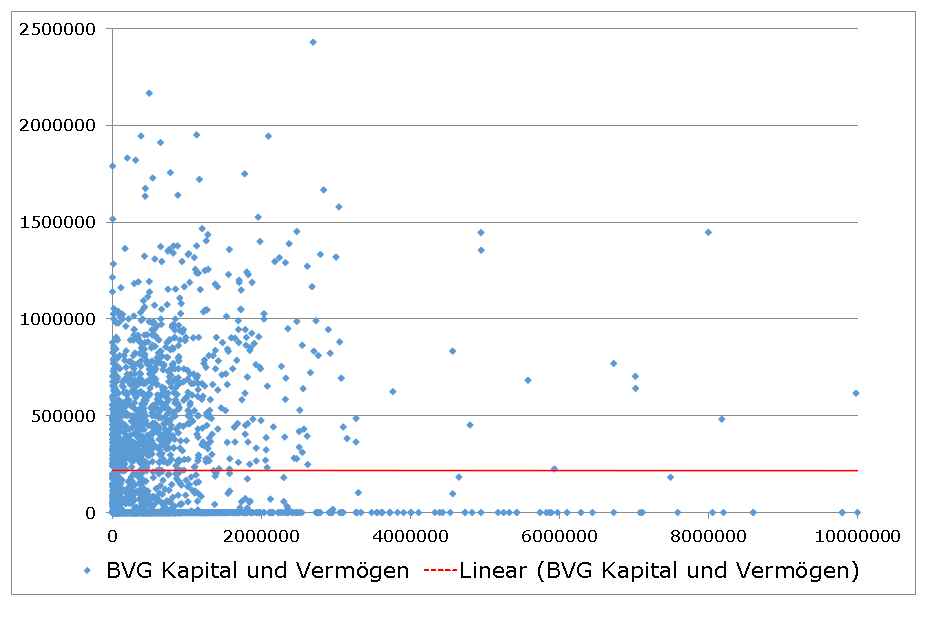Monika Bütler
Eine leicht gekürzte Version erschien unter dem Titel „Es lohnt sich, im Alter nicht den Anschluss zu verlieren“ in der NZZ am Sonntag vom 25. Dezember 2016.
Vor einem Jahr erinnerte ich mich zu Weihnachten an einen Jahrzehnte alten, geheimen Wunschtraum: Violine spielen. Mit über 50? Um mich selber zu überzeugen, erzählte ich meinen Traum bei einem Radiointerview. Nun gab es kein Zurück mehr. Ich mietete mir eine Geige.
Als ich zu Hause das Instrument aus dem Kasten hob, wurde mir bang. Zu alt, um etwas völlig Neues zu lernen? Zu ungeschickt mit einer höchstens mittelmässigen musikalischen Begabung? Gehöre ich jetzt auch zu jenen Alten, die die Jungen imitieren und sich damit nur lächerlich machen?
Mit meiner Verunsicherung stehe ich in der heutigen Zeit nicht alleine da. Nur treffen solche Ängste viele Mitt-Fünfziger – und ihre Arbeitgeber – viel existentieller. Täglich lesen wir von Stellenverlusten älterer Mitarbeiter. Weniger agil, nicht mehr lernfähig; tapsig am Computer, stumm im Kreativitätsseminar – so das Vorurteil. Auch beim – messbaren – Wissen um finanzielle Zusammenhänge (Financial Literacy) schneiden die Älteren relativ schlecht ab. Andererseits: Noch nie war ein so grosser Teil der über Ü-55 berufstätig wie heute.
Was ist an den Vorurteilen und den widersprüchlichen Zahlen dran? Zum Glück wurden in den vergangenen 20 Jahren Zahlen gesammelt. Grosse Datenprojekte wie SHARE – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – haben geholfen, Wissenslücken zu schliessen. Vergleiche über die Zeit hinweg und zwischen den Ländern, mit Hundertausenden (anonymer) individueller Daten, erlauben die Identifikation kausaler Zusammenhänge.
Und die Forschungsresultate sind für einmal eindeutig: Die Alten abzuschreiben, ist dumm. Ältere Mitarbeiter sind nicht weniger produktiv als Junge. Nicht einmal am Fliessband: Eine etwas tiefere Geschwindigkeit machen die Älteren wett mit höherer Zuverlässigkeit und tieferen Fehlerquoten.
Beängstigend ist allerdings der starke negative Zusammenhang zwischen vorzeitiger Pensionierung und einem Verlust kognitiver Fähigkeiten. Zwar geht die Kausalität in beide Richtungen. Natürlich verlieren Menschen mit nachlassenden Fähigkeiten ihren Job eher als andere. Doch die Forschung zeigt auch, dass ein früher Ausstieg aus dem Erwerbsleben zu einem Nachlassen wichtiger Fähigkeiten führt. Denn selbst als unangenehm empfundene Beschäftigungen halten das Gehirn auf Trab. Und die Arbeit verhindert eine soziale Isolation.
Den Anschluss nicht zu verlieren lohnt sich also. Und es geht. Zugegeben, es ist schwierig für Hans, eine neue Technik (oder ein neues Instrument) zu erlernen. Doch ist es das für Hänschen nicht auch? Der schmerzhaft langsame Unterricht, den wir an Schulbesuchen erleben, ist kein Zeichen unqualifizierter Lehrerinnen. Auch kleine Köpfe brauchen Zeit und vor allem viel, viel Übung.
Es ist vielleicht mühsamer, im fortgeschrittenen Alter noch etwas zu lernen. Aber unmöglich ist es nicht. Wichtiger als Begabung sind – im Alter nicht notwendigerweise schwächer – Disziplin und Zuversicht. Am Arbeitsplatz setzt Zuversicht voraus, dass beide Seiten daran glauben: Nicht nur die Angestellte, sondern auch die Chefs. Und dass beide Seiten um die Mühsal des lebenslangen Lernens wissen. Vielleicht sollten wir an Management-Trainings, statt noch mehr Case Studies und Theorie, die Teilnehmer etwas komplett Neues lernen lassen. Es muss ja nicht Geige sein, es geht auch mit Stricken oder Suaheli. Wer sich selber mit etwas neuem abmüht, hat eher Verständnis und Geduld für die Lernenden. Und – traurig aber wahr: die meisten schaffen es nicht von alleine. Es braucht Unterstützung, vielleicht sogar sanften Druck. Das ist bei Hans nicht anders als bei Hänschen.
Schon die ersten Erfolgserlebnisse helfen. Auch bei mir. Als ich am vierten Advent die Weihnachtslieder probte und insgeheim über schwierige Stellen und meinen kratzigen Stil fluchte, ging plötzlich die Türe auf. Vor mir stand mein jüngerer Sohn – ein Teenager –, die eigene Geige in der geübten Hand, und fragte: „Mama, darf ich mitspielen? Zusammen klingt es so schön.“