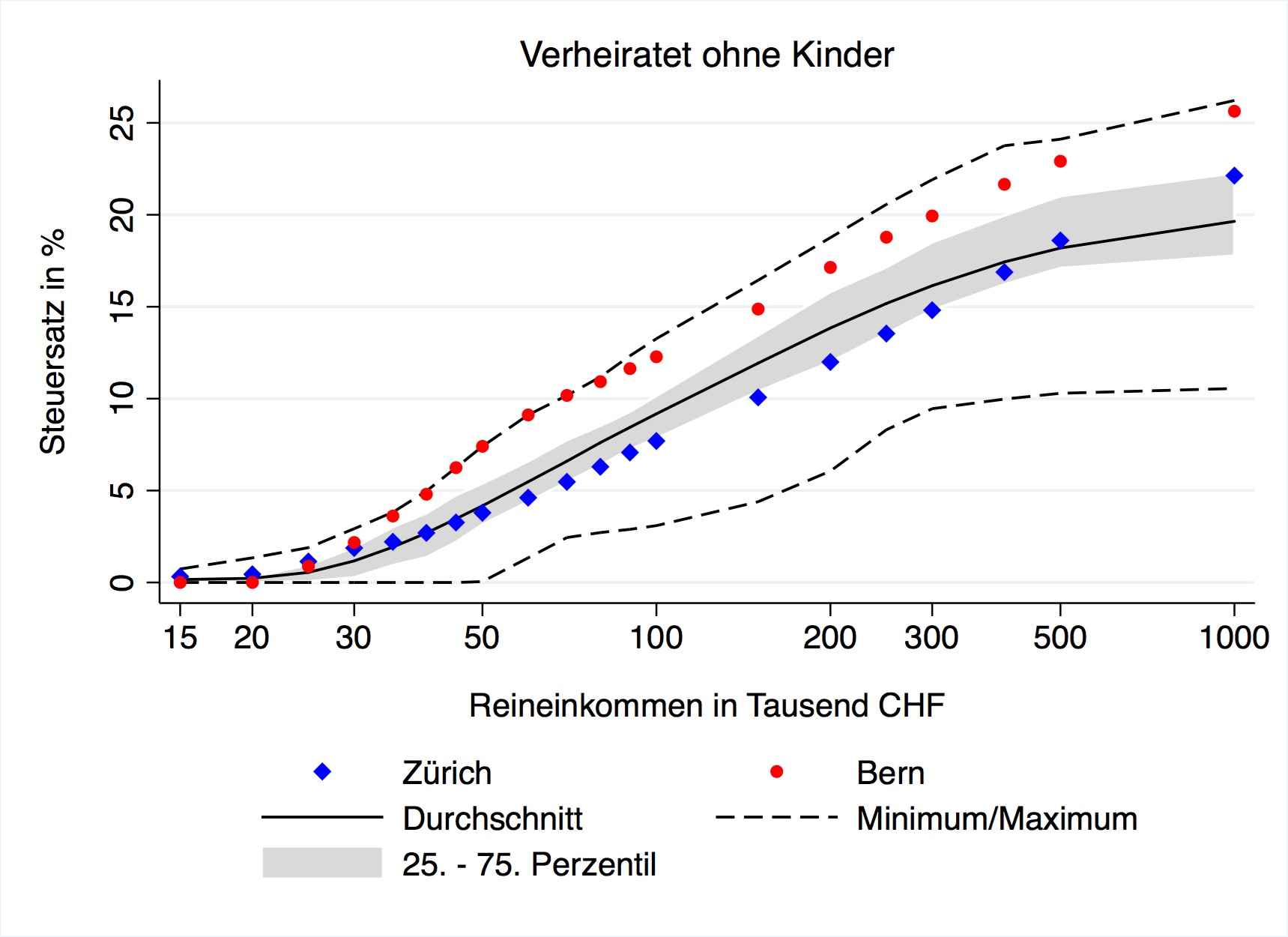Marius Brülhart
Die Luzerner Stimmbürger werden im September über eine Volksinitiative abstimmen, die verlangt, dass der kantonale Unternehmenssteuersatz von 1.5% auf 2.25% angehoben wird. Ein idealer Anlass, um über die Auswirkungen kantonaler Firmensteuern nachzudenken – und sich der Komplexität der Materie wieder einmal bewusst zu werden.
Die Kernfrage bei solchen Entscheiden lautet immer gleich: Wie würde sich eine Steuererhöhung auf das Steuersubstrat und letztlich auf die Steuereinnahmen auswirken? Je empfindlicher das Steuersubstrat reagiert, desto weniger attraktiv ist eine Steuererhöhung. Wenn die Firmen in Scharen davonzulaufen drohen, dann behelligt man sie besser nicht zu stark.
Könnte man jedenfalls meinen.
Luzern liefert uns dazu trefflichen Anschauungsunterricht. Im Jahr 2012 haben die Luzerner die kantonale Gewinnsteuer um die Hälfte von 3% auf den schweizweit tiefsten Satz von 1.5% gesenkt. Dieser markante Steuerschnitt erlaubt uns, anhand der danach beobachteten Entwicklungen grob abzuschätzen, welche Reaktionen Unternehmenssteueränderungen nach sich ziehen.
In Luzern ausgewiesene Gewinne haben eindeutig auf die Steuersenkung reagiert: Die steuerbaren Gewinne stiegen 2012 innert Jahresfrist um eine knappe Milliarde an (gemäss EFV-NFA-Datenbank). Dies entspricht einem Wachstum von Luzerns Anteil an der gesamtschweizerischen Gewinnsumme um stolze 40%. Der Anstieg war keine Eintagsfliege, denn im 2013 konnte Luzern seinen gewachsenen Teil am nationalen Gewinnkuchen halten. (Aktuellere Daten liegen bei der EFV noch nicht vor.)
War die Luzerner Steuerstrategie somit ein Erfolg, und jedes Zurückkrebsen wäre nun ein Fehler? Zur umfassenden Beurteilung dieser Frage sind drei weitere Aspekte zwingend zu berücksichtigen.
Erstens ist nicht matchentscheidend, dass sich das Steuersubstrat im umgekehrten Verhältnis zur Steuerbelastung entwickelt, sondern das Ausmass in welchem dies geschieht. Damit sich eine Steuererhöhung garantiert nicht lohnt, müsste das Steuersubstrat im Verhältnis zur Steuerbelastung überproportional reagieren. Dann befände man sich in der paradoxen Welt rechts auf der Laffer-Kurve, wo die Steuereinnahmen sinken, wenn man die Steuern erhöht. Davon ist Luzern weit entfernt. Auch die zusätzliche Milliarde an ausgewiesenen Unternehmensgewinnen im Jahr 2012 reichte nicht, um die Halbierung des Steuersatzes wettzumachen. Die Luzerner Unternehmenssteuereinnahmen (inklusive Bundessteueranteil) brachen nämlich von 180 Millionen im Jahr 2011 auf 132 Millionen im 2012 ein, und lagen im 2014 immer noch nur bei 172 Millionen. Im Durchschnitt über die beiden Jahre betrugen die Ausfälle also ungefähr 30 Millionen.
Nun gilt es zweitens zu berücksichtigen, dass Firmen und deren Mitarbeiter auch noch andere Steuern zahlen – in erster Linie Einkommenssteuern. So ist durchaus denkbar, dass die Luzerner Steuersenkung zwar nicht ausreichend Unternehmensgewinne generierte um die Ausfälle bei der Unternehmenssteuer zu kompensieren, aber dass der gesamte Staatshaushalt dank zusätzlicher Beschäftigung trotzdem profitiert hat.
Während die Firmengewinne nach der Steuersenkung um 40% hochschnellten, stiegen die Einkommen natürlicher Personen zwischen 2011 und 2013, gemessen an den gesamtschweizerischen Einkommen, um bloss 4%. Ein geraumer Teil der zusätzlichen Firmengewinne scheint daher nicht auf realem Wachstum durch Expansion, Neugründungen oder Zuzügen von Unternehmen zu beruhen sondern auf buchhalterischen Operationen.
Aber natürliche Personen zahlen viel mehr Steuern als Firmen. Im Jahr 2011 nahm der Kanton Luzern 631 Millionen Franken Einkommenssteuern ein. Ein durch die Unternehmenssteuersenkung ausgelöster Einkommenszuwachs um 4% bescherte dem Staat somit grob geschätzte 25 Millionen an zusätzlichen Einnahmen.
Somit hielten sich die Ausfälle bei der Unternehmenssteuer und die Mehreinnahmen bei der Einkommenssteuer wohl so ungefähr die Waage. Die Steuersenkung war für den Staat in dieser Betrachtung weder ein Bombengeschäft noch ein teurer Fehler. Und umgekehrt wäre eine Annahme der Steuererhöhungsinitiative voraussichtlich ungefähr budgetneutral für den Luzerner Primär-Staatshaushalt.
Allerdings darf kein kantonaler Finanzdirektor die Rechnung ohne den NFA machen. Der dritte und wichtigste Aspekt nämlich ist, dass sich die Steuerpolitik der Kantone im Korsett des nationalen Finanzausgleichs bewegt. In diesem System sind zusätzliche Firmengewinne für die meisten Empfängerkantone ein Verlustgeschäft. Das hat Lukas Rühli trefflich illustriert.
Anhand der vorliegenden NFA-Berechnungen für 2016 und 2017 kann man davon ausgehen, dass der Anstieg der Firmengewinne nach der Steuersenkung von 2012 den Luzerner Fiskus ab 2018 jährlich ca. 180 Millionen Franken an Mindereinnahmen aus dem Ressourcenausgleich kosten wird (die Zahlungen werden jeweils mit sechsjähriger Verzögerung angepasst).
Würde die Reform nun wie von der Initiative vorgeschlagen zur Hälfte rückgängig gemacht, könnte dies mittelfristig wieder die Hälfte des Einnahmenrückgangs, das heisst gegen 90 Millionen Franken, zusätzlich in die Luzerner Staatskasse spülen. Dies ist mehr als die Initianten selber prognostizieren.
Nun kann man mit Recht anführen, all dies sei eine statistische Betrachtung, da sich Luzern in einem Umfeld von dahinschmelzenden kantonalen Unternehmenssteuersätzen positionieren muss. Eine solche dynamische Sicht verstärkt meine Diagnose: je kompetitiver die Nachbarkantone, desto grösser wird für Luzern das Manna aus dem NFA-Topf.
Eine Weiterführung oder Intensivierung der Tiefsteuerstrategie könnte sich allenfalls dann lohnen, wenn sich Luzern vom Empfänger- zum Geberkanton mausern würde. Aber das scheint nicht realistisch. Sogar der massive Zuwachs an Steuersubstrat infolge der Steuerhalbierung von 2012 hat nur knapp die Hälfte des Rückstands des Luzerner Ressourcenindex zum notwendigen Schwellenwert wettgemacht.
Markant verändern würde sich die NFA-Wirkung hingegen infolge der geplanten Tiefergewichtung von Firmengewinnen bei der Unternehmenssteuerreform III. Schrumpfendes Unternehmenssteuersubstrat würde dann gemäss der aktuellen Simulationsrechnungen nur noch 38% so stark durch höhere NFA-Beiträge kompensiert wie im jetzigen System. Die Reform wird allerdings frühestens ab 2019 relevant. Jede Veränderung des Luzerner Steuersubstrats vor diesem Datum unterliegt also noch dem gegenwärtigen NFA-Kompensationsmechanismus.
Aus rein fiskalischer Sicht hat Luzern somit einen Anreiz, seine Unternehmenssteuern zu erhöhen, und zwar möglichst rasch.
Der NFA ist und bleibt ein Steuerwettbewerbs-Lusthemmer.