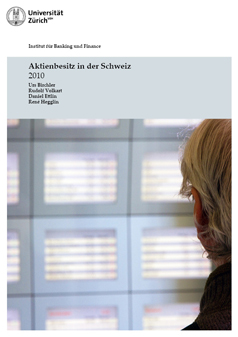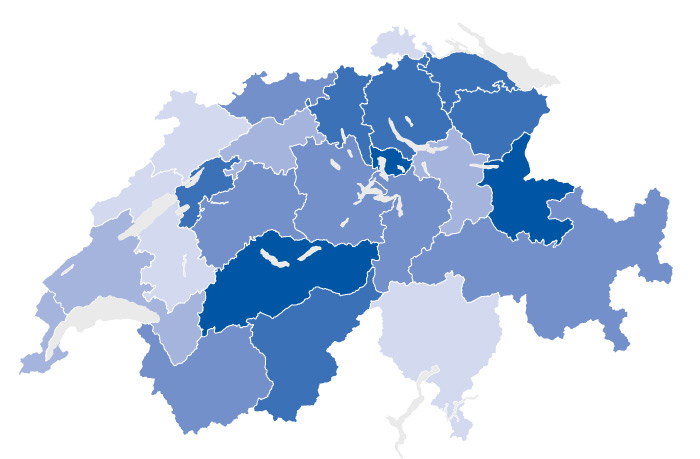Monika Bütler
Die Journalistin Birgit Schmid (Das Magazin) erhielt für ihren Artikel über Frauen, die Karriere machen könnten aber dies gar nicht wollten, sehr viele Reaktionen (Das Magazin Nr 6: „Das bequeme Leben“). In der Folge wurde ich vom Magazin gebeten, mich „mit dem Thema aus der Sicht meiner Zunft auseinanderzusetzen“. In seinem Editorial (19. März 2011) meint der Chefredaktor des Magazins: „Auch wenn in einer freien Gesellschaft für niemanden eine Verpflichtung besteht, das vom Staat relativ günstig zur Verfügung gestellte Gut „Bildung“ zurückzubezahlen, spricht die Professorin der Universität St. Gallen interessanterweise doch von einem „impliziten Gesellschaftsvertrag“, den es einzuhalten gälte.“
Hier also der Text:
Meine Eltern hatten keine einfache Aufgabe. Dauernd mussten sie der Verwandtschaft erklären, weshalb sie ihre beiden Töchter – meine Schwester und mich – studieren liessen. Selber beide aus einfachen Verhältnissen stammend, waren sie innerlich nicht gewappnet gegen das Argument: „Sie brauchen doch kein Studium, sie heiraten ja doch“.
Geheiratet haben wir tatsächlich, Kinder gekriegt auch. Und arbeiten trotzdem mit Freude weiter. Dafür, meint die Umgebung, müssen wir uns jetzt rechtfertigen. Berufliches Engagement ist bei Müttern jedenfalls verdächtig. Salonfähig geworden ist hingegen das, was man unseren Eltern, bzw. uns Töchtern noch moralisch missbilligend unterstellte: Das Studium ohne ernsthafte Berufsabsichten.
Erstmals aufgefallen ist mir dies wegen eines Leserbriefs in einer Australischen Zeitung. Gezeichnet mit „stay-home medical doctor XY“ pries er vollmundig die Rolle „Dr. med. am Herd“. Als Ökonomin leuchtete mir ein rotes Lämpchen auf. Nicht, dass ich fremde Lebensentwürfe moralisch bewerten oder gar missbiligen möchte – im Gegenteil. Ökonomie ist eine tolerante Wissenschaft. Sie bezweckt – allen Vorurteilen zum Trotz – nicht die Maximierung des materiellen Wohlstands (oder dessen kruder Messgrösse, des Bruttoinlandprodukts), sondern der viel weiter gefassten Wohlfahrt. Das heisst: Es geht uns dann am besten, wenn jede das machen kann, was ihr persönlich die grösste Befriedigung bringt: Mit den Kindern zu Hause bleiben, in Zürich oder in Filisur wohnen, sich mit Auto oder ÖV fortbewegen, sich krank schuften oder sein Potential verkümmern lassen.
Aber, damit die freie Wahl des Lebensentwurfs nicht andere unzulässig einschränkt, muss eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein: Wer konsumiert, zahlt auch. Auch für die in Anspruch genommenen Dienste des Staates müssen korrekte Preise gelten. Sonst wird die Wahl verzerrt. Oder auf Deutsch: Die Kosten des eigenen Lebensentwurf sollten nicht andere bezahlen müssen.
Gerade die akademische Bildung erfüllt diese Regel nicht. Zumindest in der Schweiz bietet der Staat ein Studium praktisch gratis an. Er hat ein Interesse daran, dass Chirurginnen, Sprachwissenschafter und vielleicht sogar Ökonominnen ausgebildet werden. Allerdings geht er davon aus, dass die gratis Ausgebildeten später auch etwas tun und ihre Fähigkeiten der Allgemeinheit auf diese Weise zur Verfügung stehen – gegen (steuerbares) Entgelt notabene. Andernfalls geht die Rechnung für die Gesellschaft langfristig nicht auf.
Dass der Staat rechnen muss, ist anscheinend noch nicht ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Im Gegenteil – verschiedene Argumente versuchen das Modell „Studium ohne Erwerbsabsicht“ zu verteidigen. Die Sekretärin einer kantonalen Jungen SVP erklärte in der NZZ am Sonntag unverblümt: „Ich werde im Herbst ein Studium beginnen – trotzdem möchte ich, wenn ich Kinder kriege, für sie da sein und nicht mehr arbeiten.“
Diese Sichtweise hat ökonomisch wenigstens noch einen wahren Kern. Das Studium dient als Versicherung für den „Schadenfall“ Kinderlosigkeit, ein Fall für den kein kommerzielles Unternehmen eine Police anbietet. Nur ist ein Studium eine sehr teure Versicherung, da von zehn Studentinnen nur etwa zwei ungewollt kinderlos bleiben. Die Versicherung lohnt sich für die Versicherten nur, weil der Staat die hohen Prämien zahlt.
Das zweite Argument hat wenig mit Ökonomie zu tun. Im erwähnten Leserbrief der Ärztin am Herd preist diese – ohne Gewissensbisse angesichts des Gratisstudiums – ihre Rolle aufgrund der moralischen Überlegenheit des traditionellen Familienmodells. Weshalb dieses Modell eine Medizinerin erfordert, bleibt offen. Auch provoziert die moralische Argumentation Gegenreaktionen auf derselben Ebene. Die deutsche Publizistin Bascha Mika – zu allem Überfluss kinderlos – stach in ein Wespennest: Mütter seien feige, weil sie sich dem harten Berufsalltag nicht stellten. Die Reaktionen liessen nicht auf sich warten: Wie entspannend das Berufsleben sei und wie hart der Alltag mit kleinen Kindern (was auch berufstätige Mütter bestätigen können).
Der Vorwurf, nicht berufstätige Mütter seien auf Kosten anderer „faul“, führt nicht weiter. Lebensentwürfe sind und bleiben Privatsache. Bleibt eine Krankenschwester zuhause bei den Kindern, ist kaum etwas einzuwenden. Sie hat sich – wie die meisten Lehrlinge – auf eigene Kosten ausgebildet. Anders die nicht erwerbstätige Ärztin: Ihr hat der Staat die teure Ausbildung bezahlt, und einen der knappen Laborplätze zugeteilt, für den auch andere Interessenten bestanden. Sie ist ihren Kindern deswegen noch nicht die bessere Mutter als die Krankenschwester. Aber sie fehlt bei der Betreuung der Kranken. Sie darf man schon fragen, weshalb sie ihre Fertigkeiten kaum nutzt.
In Internetforen findet man zwei typische Reaktionen. Erstens: Das Studium ist nicht nutzlos, es kommt über die Kinder wieder an die Gesellschaft zurück. Zweitens, es besteht keine Bringschuld gegenüber dem Staat; auch wer ein Studium abgeschlossen hat, schuldet der Allgemeinheit nichts. Mich überzeugt keine der beiden Antworten.
Es ist natürlich eine Mär, dass die akademische Ausbildung einer nicht berufstätigen Mutter für die Gesellschaft genau so wertvoll sei wie bei einer berufstätigen Mutter. Vielleicht liegt der Chirurgin auch das Rüstmesser gut in der Hand, und die Chemikerin versteht, warum die Bratwurst schwarz wird – doch der Wert der meisten Abschlüsse zuhause ist gering oder, wie im Falle meines Mathematik-Diploms gleich null. Dort wo die Ausbildung nützlich ist, beispielsweise als wunderbares Zuhause bei der studierten Innenarchitektin, bleibt der Mehrwert in den allermeisten Fällen rein privat.
Das zweite Argument, es bestehe keine Bringschuld gegenüber dem Staat, stimmt zwar rein rechtlich. Gleichwohl verletzt es den impliziten „Gesellschaftvertrag“. Der Staat bildet aus, damit seine Bürger später vom Know-How profitieren und die Kosten der Bildung über Leistungen und Steuereinnahmen begleichen. Wird der zweite Teil des impliziten Vertrags nicht eingelöst, ist auch der erste Teil – die fast kostenlose akademische Bildung – gefährdet.
„Volkswirtschaftlich ist es absurd, das Potential der vielen Hochschulabsolventinnen brachliegen und verkümmern zu lassen“ schrieb Birgit Schmid im Magazin vom 27. Februar 2011. Die Gesellschaft leistet sich also den Luxus, die teure Ausbildung fast gratis abzugeben – auch an diejenigen, die von ihr kaum Gebrauch machen.
Was sind die Folgen? Es wird zu viel studiert, gerade auch in „attraktiven“ Fächern. Dies geht dann auf Kosten der Studiengänge mit guten Job-Chancen (Ingenieure!) sowie der Student(inn)en mit beruflichen Ambitionen. Fast nach dem Motto „Was nichts kostet, ist nichts wert“, wird mit dem Abschluss in der Tasche zuwenig gearbeitet. Gleichzeitig fehlen der Wirtschaft ausgebildete Fachkräfte. Genauer gesagt: Sie fehlten auf vielen Gebieten gar nicht – man denke nur an die Lehrerinnen –; sie haben sich nur aus dem Erwerbsleben zurückgezogen.
Die Weltwoche-Autorin (und vor allem Mutter, wie sie ausdrücklich betont) Daniela Niederberger schreibt ohne Bedauern: „Mein Uni-Abschluss war also für die Katz.“ Die Steuergelder auch. Der Kater bleibt dem Staat. Auch wenn nur eine Minderheit der Studentinnen so denkt wie Frau Niederberger – es geht ins Geld. Mehr als die Hälfte der Studienabschlüsse, 65% sogar bei den Medizinern, gehen an Frauen. Bei den Doktortiteln sind es mehr als 40%. Ein Studium kostet pro Jahr (!) zwischen 10’000 und 100’000 Franken, fast gänzlich von der (in der Mehrheit nicht studierten) Allgemeinheit bezahlt.
Diese stille Verschwendung im Hörsaal schafft auf lange Sicht böses Blut. Erstens gegen die akademische Ausbildung der Frauen, zweitens gegen die akademische Bildung insgesamt, drittens gegen die (deutschen) Immigranten welche die Lücken bei den Fachkräften füllen.
Rein ökonomisch gesehen, wäre die Lösung eine ganz einfache: Das Studium wird soweit kostenpflichtig, dass der „private Nutzen“, also das was nicht indirekt an die Gesellschaft zurückgeht, selber berappt werden muss. Entscheidet sich jemand, das Wissen nicht zu gebrauchen, so ist das dann seine oder ihre ganz persönliche Entscheidung. „Faule“ Mütter gäbe es dann nicht mehr. Dafür arme, denn die Studiengebühren müssten ein Vielfaches der heutigen Kosten betragen.
Auch wenn ich persönlich eine Erhöhung der Studiengebühren für vertretbar halte, wäre der radikale Schritt zur Vollkostenrechnung bedenklich. Unsere Gesellschaft basiert darauf, dass auch implizite Verträge nach Möglichkeit eingehalten werden. Wenn wir für alles und jedes ein Preisschild anbringen müssen, geht etwas verloren. Die „braucht-keine-Ausbildung-heiratet-ja-doch“-Einstellung meiner Verwandtschaft wirkt heute skurril. Ein ganz kleines bisschen verstehe ich sie doch.

 In der Katastrophe werden die Grenzen der Wirtschaftswissenschaft schmerzhaft spürbar. Ein bisschen Trost haben wir heute in der abgebildeten Grafik gefunden. Sie zeigt, dass in diesen Tagen an der Südspitze Japans die Kirschblüte beginnt und dann nordwärts das ganze Land mit ihrem rosa Schleier überzieht. Wir grüssen mit ihr nicht nur unsere Leser, sondern auch all unsere japanischen Kollegen und Freunde.
In der Katastrophe werden die Grenzen der Wirtschaftswissenschaft schmerzhaft spürbar. Ein bisschen Trost haben wir heute in der abgebildeten Grafik gefunden. Sie zeigt, dass in diesen Tagen an der Südspitze Japans die Kirschblüte beginnt und dann nordwärts das ganze Land mit ihrem rosa Schleier überzieht. Wir grüssen mit ihr nicht nur unsere Leser, sondern auch all unsere japanischen Kollegen und Freunde.