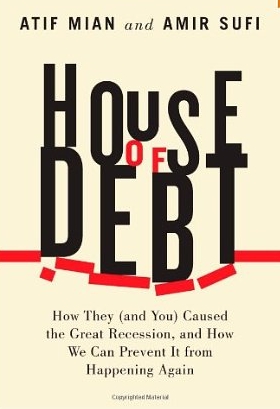Urs Birchler
Der portugiesische Banco Espírito Santo muss (trotz Werbung durch Cristiano Ronaldo) gerettet werden. „Ohne Staatsgeld“, lügen die Verantwortlichen. Die Elemente der Rettung:
- Die Bank wird aufgespaltet in eine „bad bank“ und eine gute namens Novo Banco.
- Der Novo Banco erhält eine Finanzspritze von 4,9 Mrd. Euro.
- Der Novo Banco wird (bis zu einem Verkauf) übernommen von einem Auffang-Fonds, den die Banken selbst gebildet haben. Der Fonds hat aber nur wenig Mittel; der grösste Teil der 4,9 Mrd. Euro bestehen deshalb in einem Hilfskredit des Staates (aus Geldern der „Troika“, genauer: aus dem IMF/EU-Hilfsprogramm für Portugal).
- Die normalen Einleger kommen in die gute Bank; Aktionäre (von der Börse seit Juni schon mit einem Verlust von 90% gebeutelt) sowie nachrangige und „junior“ Gläubiger und erhalten die „bad bank“.
Die gute Seite: Aktionäre und ungeschützte Gläubiger werden nicht gerettet. (Ob auch Cristiano Ronaldo die bis 2022 versprochenen Werbeeinnahmen verlieren wird?). Die schlechte Seite: Ohne Geld vom Staat geht es immer noch nicht. Erstens ist auch Geld aus einem Banken-Rettungsfonds Steuergeld, nur wurde es anstatt von den allgemeinen Steuerzahlern von den Banken erhoben. Die guten Banken zahlen also für die schlechten. Zweitens war der Hilfskredit von knapp 5 Mrd. Euro kaum zu den geltenden Bedingungen am Markt erhältlich. Der portugiesische Staat subventioniert also den Novo Banco durchaus — trotz allen gegenteiligen Beteuerungen. Und hinter ihm (falls er nicht zahlen kann) die europäischen Geldgeber und der IMF (also ein kleines bisschen auch der Schweizer Steuerzahler).