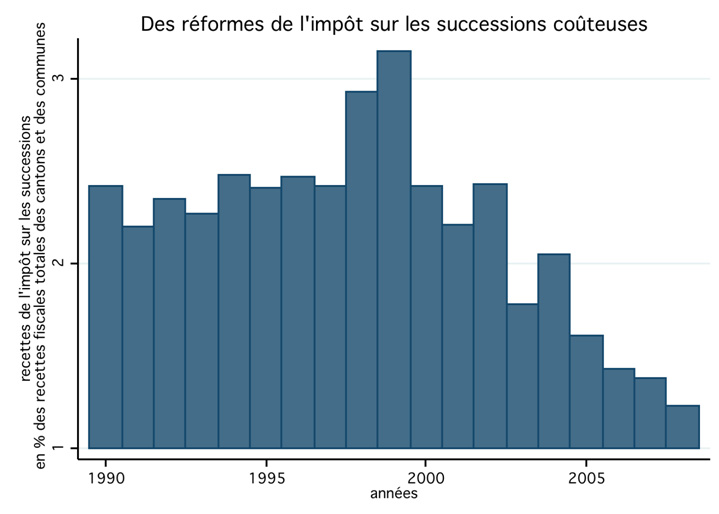Die Finanzwelt schaut gespannt nach London, dem Sitz des Committee of European Banking Supervisors (CEBS). Es ist Notenvergabe am 23. Juli. An dem Tag werden die Stresstestergebnisse für 91 europäische Banken aus 27 europäischen Ländern bekanntgegeben, von Alpha Bank in Griechenland bis Nordea Bank in Schweden. Eine ähnliche Übung fand (unter dem Titel Supervisory Capital Assessment Program) für 19 amerikanischen Banken im Mai 2009 statt. In den USA war das Resultat ein grösstenteils positives. Die Finanzmärkte reagierten wohlgesonnen, die Aktienpreise der Banken stiegen.
Die Finanzwelt schaut gespannt nach London, dem Sitz des Committee of European Banking Supervisors (CEBS). Es ist Notenvergabe am 23. Juli. An dem Tag werden die Stresstestergebnisse für 91 europäische Banken aus 27 europäischen Ländern bekanntgegeben, von Alpha Bank in Griechenland bis Nordea Bank in Schweden. Eine ähnliche Übung fand (unter dem Titel Supervisory Capital Assessment Program) für 19 amerikanischen Banken im Mai 2009 statt. In den USA war das Resultat ein grösstenteils positives. Die Finanzmärkte reagierten wohlgesonnen, die Aktienpreise der Banken stiegen.
Für die europäischen Banken hingegen ist die Lage wesentlich angespannter. Zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden und dem CEBS herrscht Unstimmigkeit, wie viele Informationen wann veröffentlicht werden sollen. Zusätzlich fehlen noch genaue Informationen über die Methodik der Belastungstests. Analytiker raufen sich die Haare: Welcher Prozentsatz wird für die Verlangsamung der Konjunktur in den Stressszenarios angenommen? Welcher Abschlag wird auf auf griechische oder spanische Staatsanleihen angenommen? Der Markt ist verunsichert. Kopfschmerzen bereitet auch der Gedanken an die schwächeren Banken, z. Bsp. an die spanischen Sparbanken und die deutschen Landesbanken. Die Stresstests würden an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn alle Banken sie bestehen. Doch es ist nicht klar, was mit denen Banken geschehen wird, die „durchfallen“. Nicht alle „Eltern“ können sich die teuren Kosten der Nachhilfe leisten. Unter diesen Umständen ist es unklar, ob die Stresstests zur Stärkung oder Schwächung des Vertrauens in die europäischen Banken führen. Die Stunde der Wahrheit ist am Freitag, um 19 Uhr, dann wird das CEBS die Noten in einer Pressekonferenz bekanntgeben. Doch damit ist das Nägelbeissen noch nicht vorbei. Dann muss noch bis Montag gewartet werden, um zu sehen wie der Handel an den Börsen in Europa auf die Resultate reagiert.