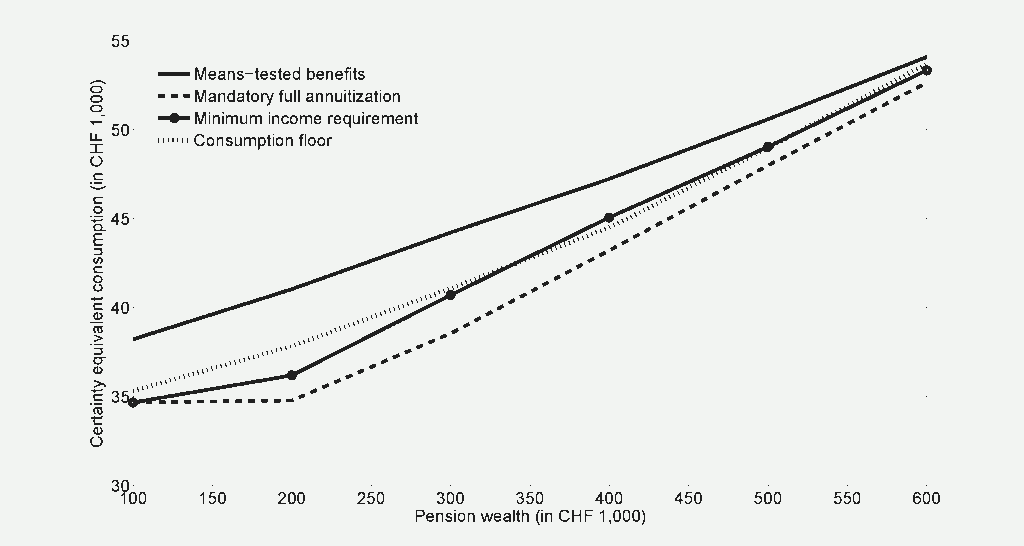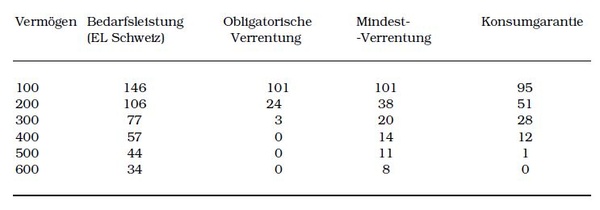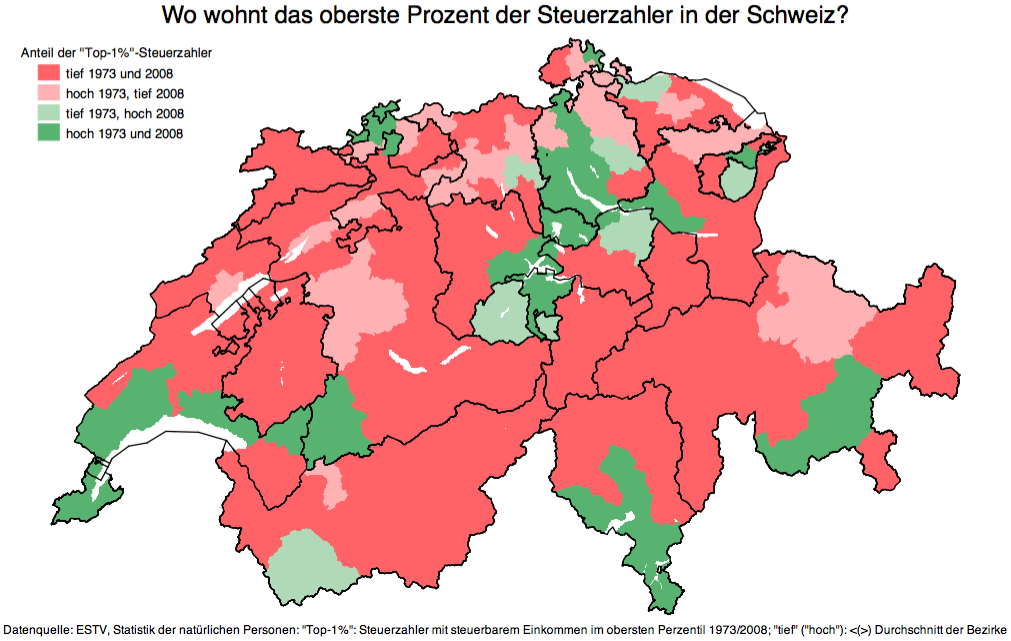Reto Föllmi
Wer die laufenden politischen Diskussionen in Europa verfolgt, könnte zur Ansicht gelangen, wir müssten uns zwischen Sparen oder Wachstum entscheiden. Nach dem Wahlsieg von Hollande in Frankreich werden die Stimmen in Europa immer stärker, die eine Abkehr vom Sparkurs und stattdessen mehr Wachstum fordern. Deren Befürworter werfen den anderen vor, die Wirtschaft kaputtzusparen oder gar abzuwürgen, um nur ein paar Schlagworte zu nennen.
Als Ökonom reibe ich mir die Augen und frage mich, wie es denn zu diesem Gegensatz kommen kann. Schliesslich kann der Einzelne ja in seinem Haushalt oder Betrieb nicht mehr ausgeben als einnehmen. Warum um alles in der Welt sollen, Staatsausgaben mit der Giesskanne oder gar direkte Verschwendung wachstumsfördernd sein?
Der erste Teil der Antwort liegt in einem etwas eigenartigen Gebrauch der Begriffe. Das erwähnte Sparen bedeutet derzeit im europäischen Kontext nur die Reduktion eines bereits bestehenden Defizits und nicht wie im Privathaushalt ein Anlegen von Überschüssen zur Vorsorge. Kommt hinzu, dass die Defizitreduktion nicht über Ausgabenkürzungen zu erreichen versucht wird, sondern mittels Steuererhöhungen.
Was hier als Sparen verkauft wird, mag zwar ärgerlich sein, die Täuschung im Wachstumsbegriff ist aber weit gravierender. Wachstum meint eigentlich die langfristige Hebung des Wohlstandes. Die ausgabefreudigen Staaten stattdessen bezeichnen eine kurzfristige Ankurbelung der Wirtschaft als Wachstum.
Der Kern der ganzen Streitfrage, und darin liegt der wichtigere zweite Teil der Antwort, ist eine grundlegende Verwechslung von kurzer und langer Frist. Kurzfristig, wenn plötzlich die Nachfrage einbricht und den Firmen die Aufträge wegbleiben, kann es durchaus Sinn machen, als Bundesstaat antizyklisch zu handeln, sinnvolle Projekte vorzuziehen oder Arbeitslose durch die ALV automatisch zu unterstützen und dadurch die Nachfrage zu erhalten.
Mittel- und langfristig kann aber eine solche Politik nicht funktionieren. Wie ein Haushalt kann auch eine Volkswirtschaft langfristig nur soviel ausgeben wie sie einnimmt, also durch Produktion erwirtschaftet. Ein konstant höheres Ausgabenniveau ist nur mit höherer Produktivität möglich. Es ist ein Irrglaube, man könne – einem Perpetuum Mobile gleich – mit Geldausgeben laufend die Wirtschaft ankurbeln.
Wie ist dann eine Erhöhung des Wohlstandes möglich? Nur durch bessere Technologien oder Investitionen z.B. in Ausbildung oder bessere Infrastruktur, ausserdem auch durch Abbau von Marktschranken für innovative neue Firmen. All diese Elemente erhöhen die Produktivität, die der Schlüssel zu nachhaltig höheren Einkommen und Wohlstand ist. Die Steigerung von Konsumausgaben führt zwar zu einem kurzfristigen Strohfeuer, erhöht aber nicht die Produktivität! Gerade im Gegenteil können die Investitionen nur aus der Ersparnis finanziert werden. Das Einzige, was durch andauernde staatliche Konjunkturprogramme dann wächst, ist der Schuldenberg.
Ein solcher Schuldenberg ist aber für das Wachstum selber ein Hemmschuh, da dieser mittelfristig wiederum irgendwie abgebaut werden muss. Wenn die Bürger die Schuldenkonsequenzen neuer Ausgabenprogramme durchschauen, werden sie mit weniger Staatsausgaben in Zukunft oder wahrscheinlicher mit höheren Steuern rechnen müssen. Das macht Investitionen noch schwieriger und lässt die Nachfrage erst recht einbrechen. Noch schlimmer kommt es, wenn aufgrund des gestiegenen Schuldenberges die Steuererhöhungen so gross sein müssten, dass die Gläubiger zu zweifeln beginnen, ob diese überhaupt durchgesetzt werden können. Die darauf steigenden Risikoprämien und Zinsen erschweren die Bedienung der Schulden aber erst recht und engen den Spielraum der öffentlichen Hand noch mehr ein. Im schlimmsten Fall wie in den Südstaaten Europas mündet das Ganze in einen Teufelskreis, an dessen Ende Hilfe von aussen oder Bankrott stehen.
Genauer betrachtet besteht damit gar kein Gegensatz zwischen haushälterischem Umgang mit öffentlichen Mitteln und Wachstum. Was für Haushalte und Kleinfirmen gilt, muss auch für eine ganze Volkswirtschaft gelten: Kurzfristig kann man Engpässe durch Kredite überbrücken, wer aber langfristig über seine Verhältnisse gelebt hat, muss zunächst in einem schmerzvollen Entzugsprogramm Defizit abbauen, bevor überhaupt wachstumsfördernde Investitionen möglich werden.
Warum wird darüber die Diskussion dennoch so intensiv geführt? Den Bürgern wurde lange Sand in die Augen gestreut, mit ständigen Anstossfinanzierungen könne auch langfristig der Lebensstandard gehoben werden. Wenn diese Subventionen länger anhalten und immer mehr Bereiche umfassen, ist für den Einzelnen der Zusammenhang zwischen erwirtschaften Einkommen durch Arbeit und Ausgaben immer weniger ersichtlich.
In der Krise wurde dieses Problem noch verstärkt. In Schieflage geratene Banken mussten mit Unsummen gerettet werden. Offensichtlich hat hier die Politik auf Kosten derjenigen gespart, die am wenigsten für sich reklamieren konnten, systemrelevant oder eben too big to fail zu sein. Hier, also bei den Konsumenten und kleineren Unternehmen, musste der Eindruck entstehen, der Zusammenhang zwischen Einkommen und Leistung sei bei den anderen ausser Kraft gesetzt. Wir gewännen viel, wenn wir die Krise dazu nutzten, unser Haus in Ordnung zu halten und diese Verschleierungen etwas zu beseitigen. Dann können Sparen und Wachstum wieder gleichermassen zu nachhaltigem Fortschritt beitragen.
Prof. Dr. Reto Föllmi, Universität St. Gallen. Artikel publiziert im „Bote der Urschweiz“ am 4. Juni 2012.