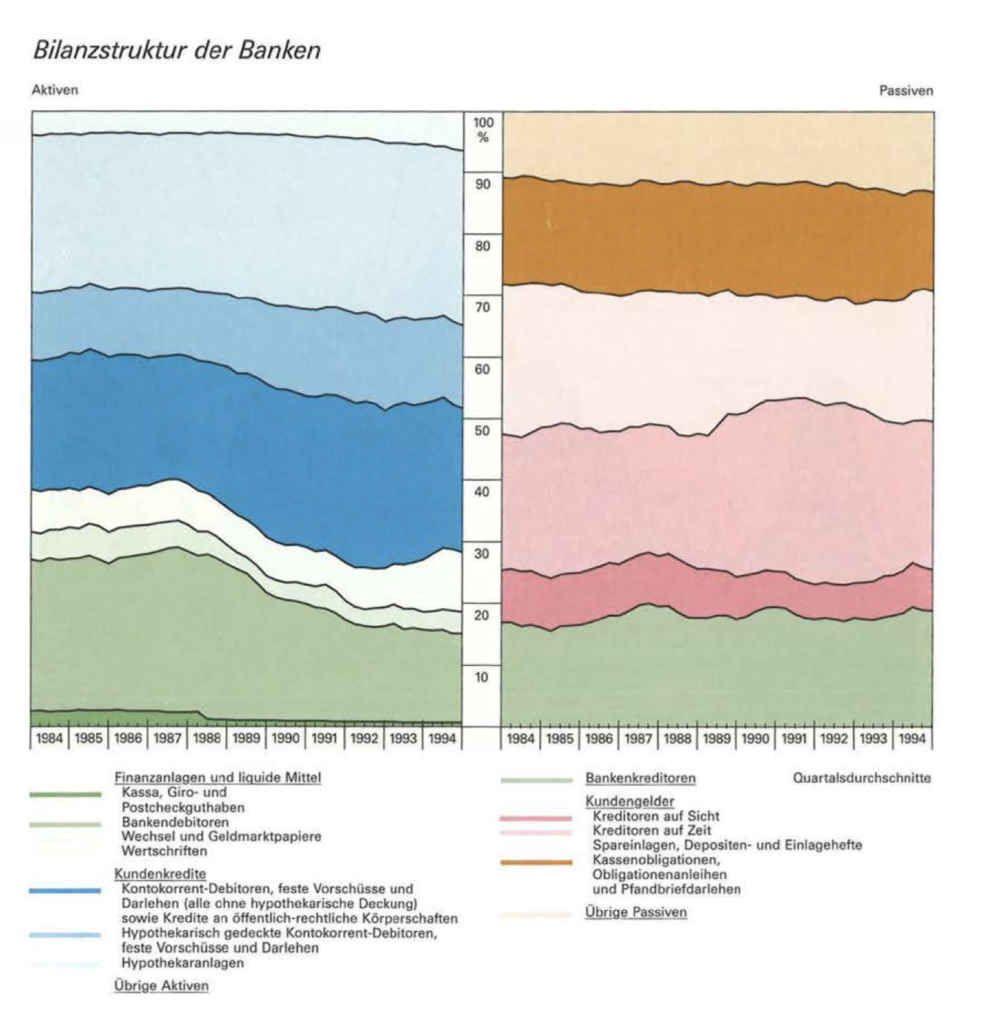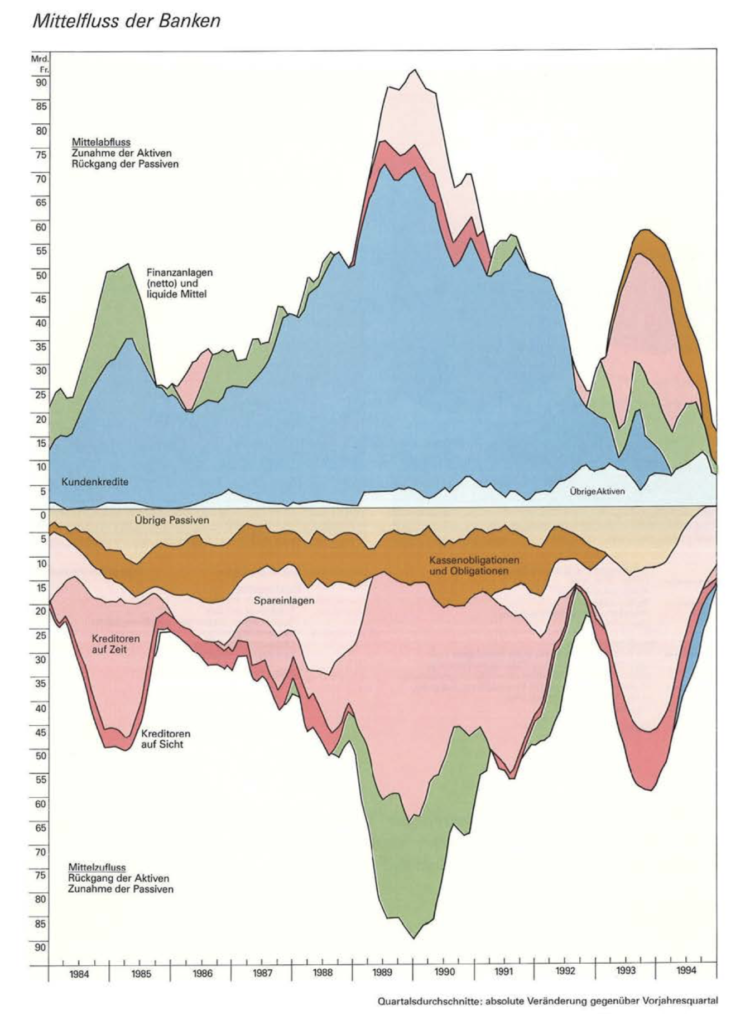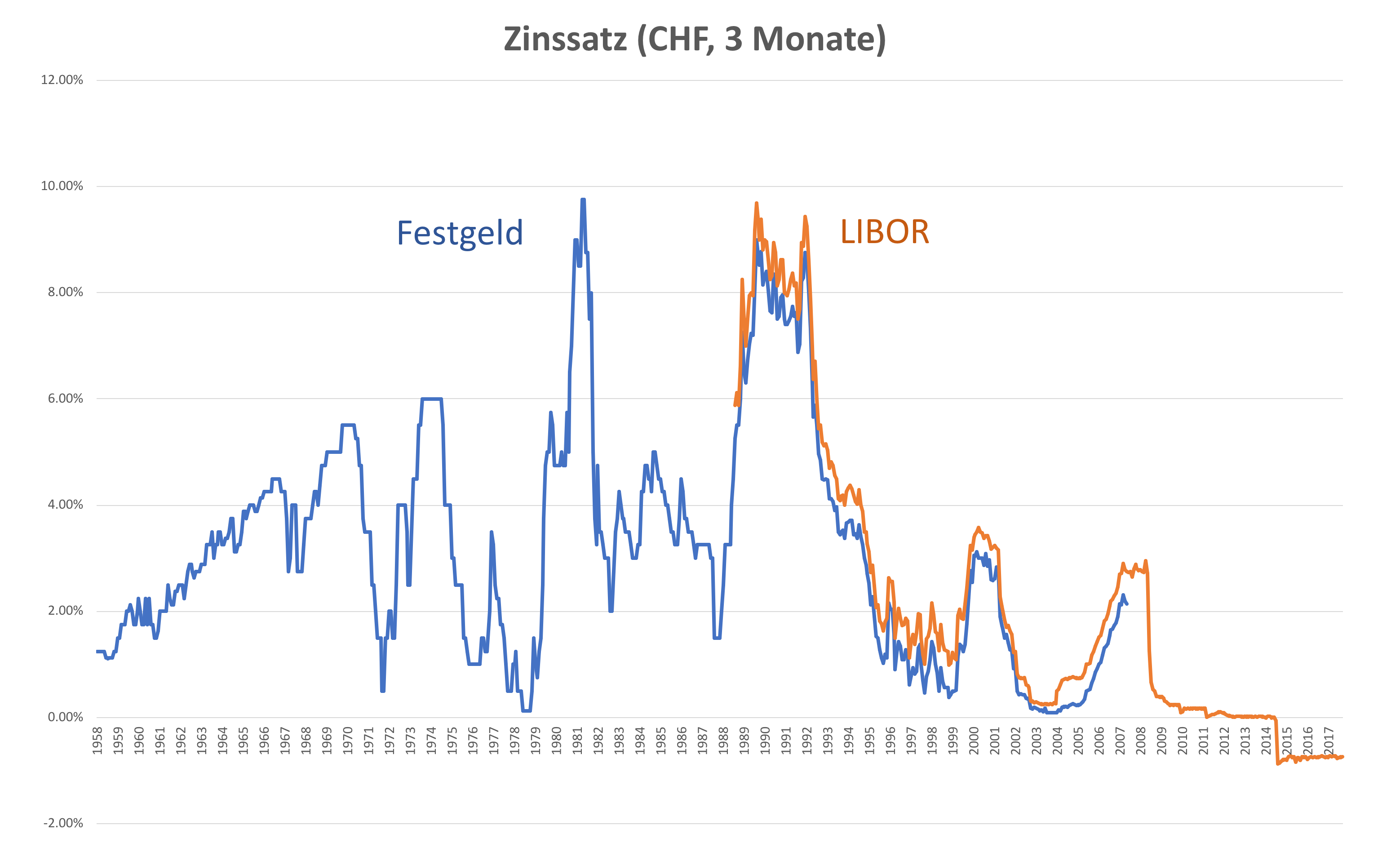Marius Brülhart
„Budgetiert wird rot, abgeschlossen wird schwarz.“ So bringt der Tages-Anzeiger auf den Punkt, wie der Bundeshaushalt im 21. Jahrhundert bislang funktioniert. Seit der Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2003 wird Jahr für Jahr weniger Geld ausgegeben als im Budget vorgesehen. Sogar in der tiefsten Finanzkrise war das so. Auch das Rechnungsjahr 2017 bot keine Ausnahme: Von den im Voranschlag gesprochenen Geldern blieben 400 Millionen als Kreditreste übrig. Und das trotz schmerzhafter Sparmassnahmen bei der Erarbeitung des Voranschlags im Dezember 2016.
Nicht voll ausgeschöpfte Budgets sind an sich kein Problem, sondern eher Ausdruck einer funktionierenden Verwaltung. Die Departemente haben in der Budgetierungsphase einen Anreiz, eine Sicherheitsmarge mit einzurechnen, denn Budgetunterschreitungen sind aus ihrer Sicht weniger problematisch als Budgetüberschreitungen. Zudem ist die Ex-post-Kontrolle von Rechnungsabschlüssen einfacher als die Ex-ante-Prüfung von Voranschlägen. (Die in jüngsten Jahren ebenfalls wiederkehrende Unterschätzung des Einnahmenwachstums – der wichtigste Grund für den ausserordentlich hohen Überschuss der Rechnung 2017 – ist ein separates Thema, welches ich hier ausblende.)
Budgetunterschreitungen sind auch in der Zukunft wahrscheinlich. Die letztes Jahr mit dem Neuen Führungsmodell der Bundesverwaltungeingeführten Globalbudgets dürften die Unterschreitungen zwar etwas eindämmen, aber im Finanzdepartement wird weiterhin mit Restposten von jährlich 0,5 bis 1 Milliarde gerechnet.
Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Ausgestaltung ignoriert dieses Phänomen. Gemäss des zentralen Verfassungsartikels hält der Bund „seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht“. Diese Vorgabe wird im Finanzhaushaltgesetz zur Zeit so ausgelegt, dass die Ausgaben bereits im Budget die erwarteten Einnahmen in der Summe über den Konjunkturzyklus nicht übertreffen dürfen.
Die so im Gesetz verankerte Praxis ist vergleichbar mit einer Fluggesellschaft, die ihre Maschinen zu füllen versucht, indem sie genauso viele Tickets verkauft wie sie Sitze zu belegen hat. Im Schnitt führt eine solcher Ansatz jedoch zu einer Unterauslastung der Flugzeuge, denn es gibt meistens einen Anteil der gebuchten Passagiere, die ihre Reise aus unvorhergesehenen Gründen nicht antreten.
Da die effektiven Ausgaben jeweils unter den budgetierten Ausgaben zu liegen kommen, impliziert die gegenwärtig angewandte Schuldenbremse nicht ein Gleichgewicht von Ausgaben und Einnahmen, sondern einen quasi eingebauten Einnahmenüberschuss. Der oberste Verfassungsgrundsatz zur Schuldenbremse und dessen Umsetzung stehen somit in einem gewissen Widerspruch.
Eine Lösung dieses Widerspruchs wäre ziemlich einfach. Genau wie die Fluggesellschaften ihre Maschinen proportional zu den erwarteten „no shows“ überbuchen, könnte man auch im Voranschlag des Bundes eine antizipative Überbudgetierung im Umfang der erwarteten Kreditreste einbauen.
Konkret könnte man den Konjunkturfaktor der Schuldenbremse , mit welchem die erwarteten Einnahmen zur Festlegung des Ausgabenplafonds multipliziert werden, anpassen. Der gegenwärtige Konjunkturfaktor besteht aus dem Verhältnis vom langfristigen Trend-BIP und dem erwarteten BIP im Budgetjahr. In schlechten Jahren ist dieser Faktor grösser als eins und erlaubt ein Defizit. In guten Jahren ist er kleiner als eins und gebietet einen Überschuss im Voranschlag. Im langfristigen Mittel jedoch ist der Konjunkturfaktor per Konstruktion gleich eins und impliziert somit ein ausgeglichenes Budget. Dies zieht aufgrund der Kreditrest-Problematik im Durchschnitt überschüssige Rechnungsabschlüsse nach sich.
Man könnte den Konjunkturfaktor um einen additiven „administrativen Korrekturfaktor“ (AK) ergänzen. Für den Konjukturfaktor gälte somit neu die Formel ((Trend-BIP / aktuelles BIP) + AK), wobei AK den Prozentanteil der erwarteten Kreditreste beziffert. Bei einem Bundeshaushalt von 70 Milliarden schiene ein Wert von 0.01 für AK durchaus realistisch. Das wären immerhin 700 Millionen pro Jahr.
Der administrative Korrekturfaktor könnte jährlich aufgrund eines gleitendenden Mittels der Budgetunterschreitungen in vergangenen Rechnungsabschlüssen ermittelt werden. Angesichts der regelmässig wiederkehrenden Natur der Kreditreste darf man von einem über die Zeit ziemlich stabilen Wert ausgehen. Je länger der Zeitraum über welchen das gleitende Mittel berechnet würde, desto höher die Stabilität des Korrekturfaktors, und desto geringer auch die Gefahr, dass Kreditreste manipuliert werden könnten zur Beeinflussung künftiger Ausgabenplafonds.
Eine solche Komplettierung des Regelwerks würde die Schuldenbremse in sich kohärent ausgestalten, indem sie nun auf ein Gleichgewicht der der tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen ausgerichtet wäre.
Die Einführung eines administrativen Korrekturfaktors würde zudem dauerhaften neuen Budgetspielraum bieten. Dieser Spielraum ginge auf Kosten einer weiteren nominalen Entschuldung des Bundes. Ein Rückbau der Nominalschuld ist aber im einschlägigen Verfassungsartikel nicht vorgesehen und auch ökonomisch nicht mehr unbedingt sinnvoll. Relativ zum BIP – und das ist die wirklich relevante Masszahl – würde die Entschuldung zudem weiter fortschreiten.
Der Expertenbericht zur Schuldenbremse , an dem ich letztes Jahr mitgewirkt habe, kam zum Schluss, dass solcher Budgetspielraum gegebenenfalls besser für Steuererleichterungen als für Ausgabenerhöhungen genutzt würde, da Kreditreste in erster Linie Ausdruck von nicht ausgeschöpften Budgetpuffern sind. Die anstehende Unternehmenssteuerreform oder Anpassungen bei der Familienbesteuerung könnten mittels einer solchen Korrektur der Schuldenbremse zumindest teilweise „gegenfinanziert“ werden. Im Prinzip könnte der Spielraum allerdings auch auf der Aufgabenseite ausgenutzt werden, zum Beispiel für höhere Zuschüsse an die AHV.
Der Expertenbericht präsentierte die hier skizzierte Anpassung der Schuldenbremse als erwägenswert, plädierte jedoch vorerst für eine Beibehaltung des Status Quo. Der Rechnungsüberschuss 2017 mit den weiterhin umfangreichen Budgetresten auch nach Einführung des neuen Führungsmodells in der Bundesverwaltung hat die Argumente für eine Anpassung der Schuldenbremse seither allerdings weiter gestärkt.