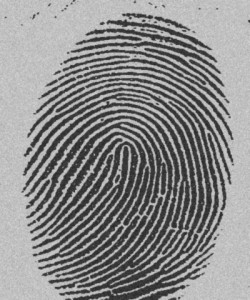Eine Zeitung meldete gestern, dass Kinder über sieben Jahre im Auto nun doch nicht schon ab dem 1. April 2010 ins Kindersitzli müssen. Diese Meldung ist falsch — leider. Bis heute gibt es nämlich keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass mit dieser Massnahme die Sicherheit der Kinder über das Angurten hinaus verbessert wird. Der wirtschaftliche Nutzen ist hingegen klarer: Produzenten der sogenennten „Kinderrückhaltevorrichtungen“, Grossverteiler und Verleger von Testmagazinen, dürften begeistert sein. Für alle anderen ist die Ausdehnung der Kindersitz-Pflicht im Auto teuer und nutzlos, wie ich im externen Standpunkt in der NZZ am Sonntag vom 29. November dargelegt habe.
Wer stoppt diesen beispiellosen bürokratischen Unsinn?
Hier mein externer Standpunkt in der NZZ am Sonntag vom 29. November 2009:
Kindersitze für 12 -Jährige sind eine lächerliche Vorschrift
Meine Schwester braucht nun doch keine Lizenz für die Betreuung unserer Kinder. Als Ersatz sozusagen haben sich die Bürokraten etwas anderes ausgedacht, was uns sicherer macht: Die Kindersitzpflicht im Auto für grössere Buben und Mädchen bis 12. Glücklicherweise haben wir kein Auto. Glücklicherweise? Nein, dummerweise, denn die Massnahme betrifft unsganz besonders. Bei akuter Atemnot mitten in der Nacht oder nach einem Skateboard-Unfall werden wir nun nicht mehr einfach ein Taxi rufen können: es kommt nur über den Umweg zur Taxizentrale oder – wahrscheinlicher – gar nicht mehr.
Als Mutter erstaunt mich zunächst, dass den Eltern nicht mehr zugetraut wird, für das Wohl ihrer Kinder zu sorgen. Normalerweise tun sie dies nämlich nicht schlecht: Dies zeigt ein Blick auf die Skipisten: Kaum ein Kind fährt mehr ohne Helm. Ohne dass dies vorgeschrieben wäre; einfach weil die Schutzwirkung den Eltern einleuchtet. Ein Verzicht auf die Sitzli-Pflicht für grössere Kinder hiesse ja nicht, dass diese Kinderrückhaltevorrichtungen (wie sie offiziell heissen) verboten würden.
Natürlich braucht es manchmal Regeln, zum Beispiel wenn Dritte gefährdet werden (Tempolimiten) oder wenn der Einzelne sein Gegenüber nicht kennt oder nicht auswählen kann (obligatorische Haftpflichtversicherung). Bei vielen Regeln übersteigen die Kosten jedoch den angestrebten Nutzen. Die Sitzli-Pflicht für grosse Kinder ist so ein Fall, und zwar ein krasser. Selbst wenn sich alle autofahrenden Eltern daran halten, nützt der Schaumstoff-Thron für Grosse praktisch nichts. Die Sitzhersteller präsentieren zwar eindrückliche Zahlen zur Schutzwirkung. Nur: In ihren Statistiken vergleichen sie stets „angegurtet im Sitz“ mit „nicht angegurtet und ohne Sitz“. Die Gurte macht aber den Unterschied.
Gurten alleine können beinahe den ganzen Unterschied in der Verletzungshäufigkeit und -schwere von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren erklären. Dies zeigt eine sorgfältige Analyse von Unfällen in den USA (Doyle & Levitt, 2008). Die zusätzliche Schutzwirkung der Sitze im Vergleich zu Gurten („restrained in any way“) ist sehr gering und meist gar nicht messbar. Wenn das schon für die 2 bis 6 jährigen gilt, bei denen die Gurten ohne Sitze offensichtlich ungeeignet sind und für die ein Obligatorium auch kaum bestritten wird, dann ist nicht mit einer Verbesserung der Sicherheit der grösseren Kinder zu rechnen.
Am meisten gefährdet durch Unfälle im Strassenverkehr sind ohnehin nicht die Kinder, die im Auto sitzen. Doppelt so viele Kinder sterben als Fussgänger oder Fahrradfahrer, bei den schweren Verletzungen sind es gar sechs mal mehr. Es erstaunt daher nicht, dass mehr und mehr Eltern ihre Kinder per Auto zur Schule fahren und so – ohne böse Absicht – die zu Fuss gehenden Kinder noch mehr gefährden.
Die Ausdehnung der Kindersitz-Pflicht bis 12 Jahre ist somit eine nutzlose Steuer für autofahrende Eltern, eine sperrige Art Kindervignette, deren Erlös direkt zum Hersteller der teuren Sitze fliesst sowie zu den Grossverteilern und den Verlegern der Testmagazine. Besonders bestraft werden die Familien ohne Auto. Also diejenigen, die nicht nur zu einerbesseren Umweltbilanz beitragen, sondern auch dafür sorgen, dass nicht noch mehr Autos die Sicherheit der Kinder gefährden. Durch den Sitzzwang wird es schwieriger, den Alltag ohne Auto zu bewältigen. Die Koffer zum Bahnhof kann notfalls auch die Mama alleine im Taxi bringen. Mit dem Loch im Kopf der Tochter oder dem Asthma-Anfall des Sohnes mitten in der Nacht, kann sie nicht allein fahren. Was tun, wenn der Taxifahrer sich weigert, ein Kind ohne Sitz zu befördern? Mit einem grosszügigen Trinkgeld bestechen oder gleich die Ambulanz rufen?
Dies mag leicht übertrieben klingen. Es geht aber nicht nur um Kindersitze. Es geht um ein Geflecht von Vorschriften, das anscheinend unkontrolliert wuchert. Die Sitzli-Pflicht für grosse Kinder wird nicht der letzte Akt in diesem Stück sein. Wir werden zwar nicht müde, Nachbarländer zu bemitleiden für ihre hohe Regulierungsdichte, aber wir leisten uns offenbar eine Bürokratie, die einen florierenden Import der geschmähten Vorschriften betreibt. Dabei wird der Unsinn in gewohnt schweizerischer Manier noch perfektioniert: Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern werden bei uns die Taxis nämlich nicht von der Sitzpflicht für grosse Kinder ausgenommen. Am Ende liegt die Schweiz da wie Gulliver im Lande Liliput – gefesselt von einer Vielzahl von Fäden, die einzeln leicht zu zerreissen wären, aber in ihrer Gesamtheit unüberwindlich sind. Dies untergräbt dann auch das Ansehen von Vorschriften dort, wo sie gerade sinnvoll oder notwendig sind. Selten lag eine Verordnung auf dem Tisch, die in ihrer Nutzen-Kosten-Bilanz derart lächerlich anmutet wie die Kinderrückhaltevorrichtungspflicht bis zum 12. Lebensjahr. Schade muss sie nicht vor die Landsgemeinde.