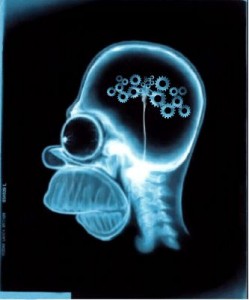Inmitten der Währungsturbulenzen scheint es angebracht, heute des 23. Januars 1973 zu gedenken. An diesem Tag beschloss die Nationalbank nach Rücksprache mit dem Bundesrat, die Dollarkäufe zur Stützung der offiziellen Parität (Mittelkurs: CHF/USD = 3.84) vorübergehend einzustellen.
In Abwesenheit des erkrankten Präsidenten der Nationalbank kontaktierte der damalige Leiter des für den Devisenhandel zuständigen III. Departements (und spätere Präsident), Fritz Leutwyler, direkt den Finanzminister Nello Celio. (Für die Festlegung der Parität war der Bundesrat zuständig). Die beiden kamen überein, angesichts der angeschwollenen Kapitalzuflüsse und der damit verbundenen Ausdehnung der Geldmenge keine weiteren Dollars zu kaufen.
Aus der vorübergehenden Massnahme — c’est le provisoire qui dure — wurde ein Dauerzustand. Dieser gibt der Nationalbank zwar die Kontrolle über die Geldmenge, nicht aber über die wirtschaftlichen Störungen aus dem Ausland. Sie ist daher seit 1973 zum Hochseilakt zwischen zu starkem Franken und zu grosser Geldschöpfung verurteilt.