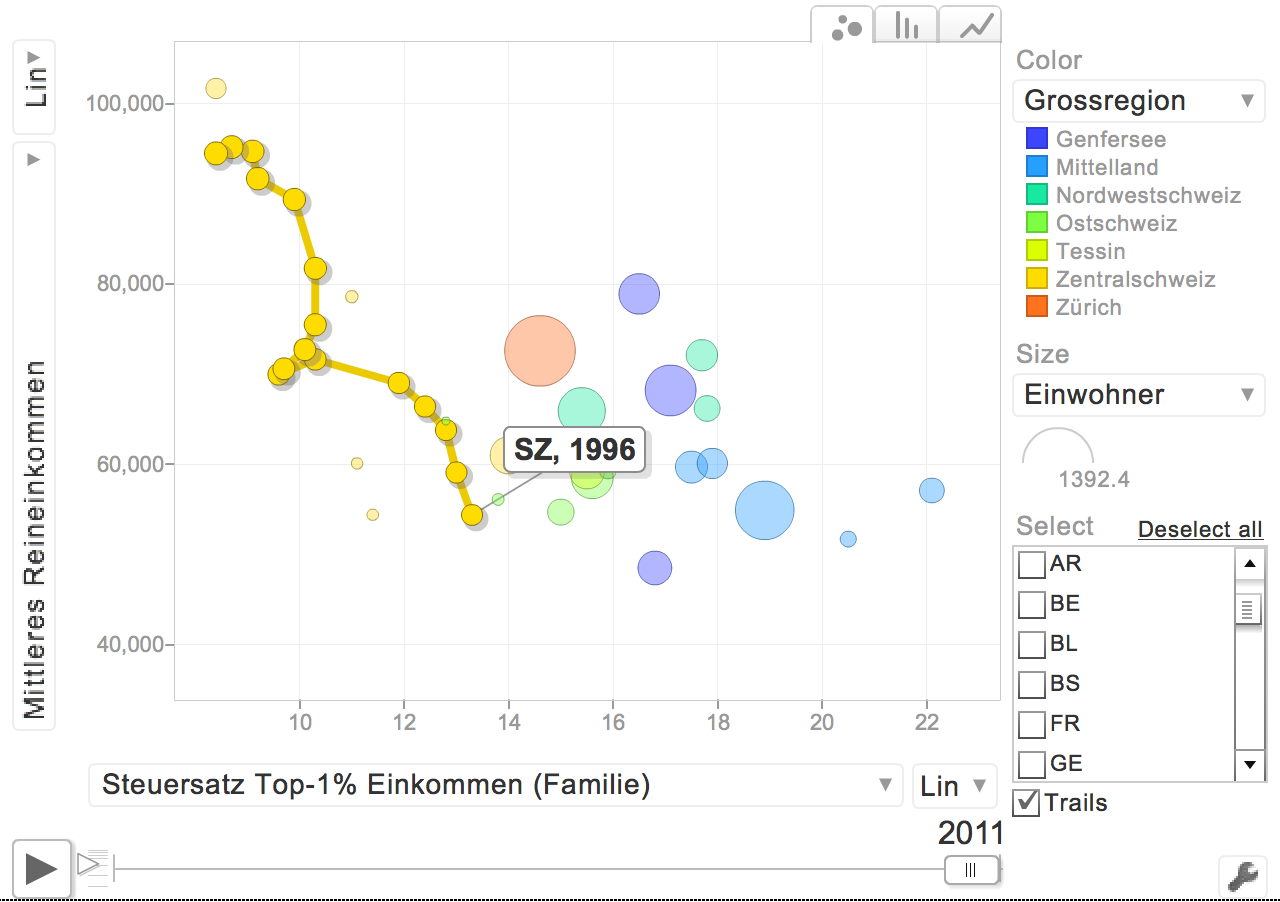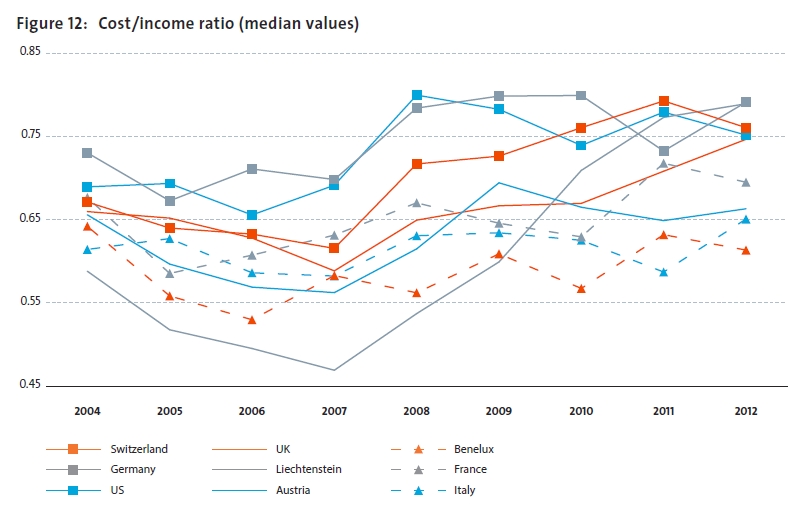Monika Bütler
(Zu Weihnachten eine kleine Liebeserklärung an die AHV, publiziert im Bulletin der Credit Suisse, 18. Dezember 2013)
Als meine Grossmutter, im Krieg mit drei kleinen Kindern verwitwet, 1948 das erste Mal eine bescheidene AHV Rente erhielt, weinte sie vor Erleichterung und Dankbarkeit. Dabei waren die rund 35 Franken pro Monat selbst für damalige Verhältnisse wenig, gerade einmal 7% des Medianeinkommens. Trotz Unterstützung ihrer Kinder lebte sie auch später in ärmlichen Verhältnissen, in einer kleinen dunklen Wohnung ohne richtige Heizung. Dennoch blieb sie zeit ihres Lebens sehr dankbar über ihre AHV Rente.
65 Jahre später: Die Schweizer Illustrierte portraitiert den „coolsten Rentner der Schweiz“, das frühere Ski-Idol Bernhard Russi, mit Jahrgang 1948 gleich alt wie die AHV. Zwischen meiner Grossmutter (die mit 66 Jahren als gebrechliche Frau starb) und dem topfitten Neurentner Russi liegen Welten. Auch zwischen der AHV von 1948 und der AHV von 2013 liegen Welten. Die Leistungen sind gemessen am Durchschnittslohn mehr als zweieinhalb mal höher als früher, sie wurden ergänzt durch eine obligatorische berufliche Vorsorge und Ergänzungsleistungen. Seit der Einführung der AHV ist die verbleibende Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren um rund acht Jahre gestiegen – meist beschwerdefreie Jahre notabene. Den heutigen «Alten» geht es heute im Durchschnitt nicht nur finanziell viel besser als früher; sie sind auch gesünder und fühlen sich jünger. Nur zwei Sachen blieben unverändert: das AHV-Rentenalter liegt unverrückbar bei 65 Jahren – wie 1948. Und die AHV ist noch immer Teil der schweizerischen Identität.
Allerdings sind da auch noch die negativen Prognosen über die künftige Entwicklung der AHV. Selbst politische Kreise, die noch vor wenigen Jahren jede Finanzierungslücke der AHV bestritten haben, müssen inzwischen eingestehen, dass sich ohne Gegenmassnahmen bald ein grosses Loch in der Versicherungskasse auftut.
Die drohende Finanzierungskrise hat der Popularität der AHV noch keinen Abbruch getan. Kaum eine schweizerische Institution ist so beliebt und in allen Bevölkerungskreisen so stark verankert wie die AHV. Die AHV ist eine Erfolgsgeschichte: In relativ kurzer Zeit konnte damit die Armut im Alter praktisch ausgemerzt werden. Dies gilt insbesondere für die Witwenarmut, die selbst in Ländern wie den USA noch immer beobachtet werden kann. Die Versicherung verursachte seit ihrer Einführung keine Skandale. Sie arbeitet schnell, transparent und mit ausgesprochen tiefen Verwaltungskosten.
Die AHV, das sind wir. Das Geheimnis dieser Liebesbeziehung? Fast alle Einwohner der Schweiz tragen zur Finanzierung der AHV bei, fast alle profitieren einmal davon. Man muss – im Gegensatz zur IV – nicht streiten, ob jemand eine Rente beziehen darf. Das Alter kann zweifelsfrei und mit geringen Kosten festgestellt werden kann. «Scheinalte» gibt es nicht.
Die Stellung der AHV ist im internationalen Vergleich einzigartig. Ihr Kürzel steht längst nicht nur für die Versicherung im Alter und beim Tod des Ernährers; es ist mittlerweile Synonym für Menschen ab 65. Während in anderen Ländern Senioren, „best agers“ oder „silver agers“ Rabatte gewährt werden, heisst es in der Schweiz beim Eingang ins Schwimmbad oder ins Museum schlicht und einfach: „Eintritt Erwachsene, Kinder & AHV…“. Sind die Züge an schönen Tagen voll, stöhnen die Pendler „die AHV ist unterwegs“, die wohl weltweit einzige reisende Sozialversicherung. Und unter den Ärger über fröhlich jassende Senioren mischt sich wohl auch etwas Neid.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ausgerechnet eine Sozialversicherung so sehr zum Selbstbild der Schweiz gehört. Eine erste Vorlage zu einem AHV-Gesetz scheiterte nämlich 1931 in der Referendumsabstimmung: an der prekären Wirtschaftslage, konservativen Wirtschaftskreisen, den Jungen für die die Beiträge zu hoch waren, den Pensionskassen, die fürchteten vom Gesetz übergangen zu werden und den Kommunisten, denen die Leistungen zu bescheiden waren. Besonders interessant dabei: Bereits damals tat sich ein Röstigraben – ebenfalls schon fast ein Teil unserer Identität – auf, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. Die Vorlage von 1931 traf nicht nur auf den Widerstand konservativer Landkantone sondern auch auf die Ablehnung welscher Kantone. In der Waadt erhielt der Vorschlag mit 24% Ja etwa gleich wenig Zustimmung wie in der Innerschweiz. (In Klammern bemerkt: Ausgerechnet der fosse du rösti, welcher heute für grosse Differenzen in Fragen zur Sozialpolitik steht, zeigt, dass die vermeintlichen Gräben vielleicht eher identitätsstiftende Folklore sind als Scheidungsgründe).
Dass die Identifikation mit der AHV so gross ist hat vielleicht mit einem weiteren Teil der schweizerischen Identität zu tun, der direkten Demokratie. Institutionen wie die Alterssicherung werden eben gerade nicht auf dem Reissbrett entworfen, sondern im politischen Prozess. Das Volk verfügt durch die direkte Demokratie sozusagen über ein Einzelpostenvetorecht, ein so genanntes «line item veto». Es ist gar nicht möglich, dem schweizerischen Souverän eine Reform der Alterssicherung als Teil eines Gesamtpaketes unterzujubeln. Jeder Bürger, jede Bürgerin ist gezwungen sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Herausgekommen ist im Falle der AHV eine einfache und übersichtliche Lösung gegen Alters- und Witwenarmut. Es gibt im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern keine Sonderlösungen für Beamte und andere Bevölkerungsgruppen. So bleibt die Versicherung auch anpassungsfähig und schlank.
Von Partikularinteressen blieb die AHV dennoch nicht verschont. Beispiel: Die Änderungen im Rentenalter der Frauen durch die damals ausschliesslich männlichen, mehrheitlich mittelalterlichen und verheirateten Bundesparlamentier. Die Senkung des anfänglich ebenfalls auf 65 Jahre festgelegten Frauenrentenalters auf 62 Jahre wurde nicht nur mit der Existenzsicherung (Frauen haben tiefere Löhne) begründet, sondern auch damit, dass die Männer und ihre im Durchschnitt drei Jahre jüngeren Ehefrauen gemeinsam in Pension sollten gehen können.
Die hohe Verankerung in der Bevölkerung hat auch Nachteile: Sie hemmt notwendige Reformen, wenn aus lauter Liebe ungünstige demographische und wirtschaftliche Entwicklungen ausgeblendet werden. An Warnungen über drohende finanzielle Ungleichgewichte aufgrund der demographischen Entwicklung fehlte es nämlich nie; die SNB schrieb bereits 1957 von einer «zunehmenden Überalterung». Nur wenn es gelingt, die an sich erfreuliche Zunahme der Lebenserwartung in der AHV zu berücksichtigen, bleibt die Versicherung auch in der Zukunft in weiten Kreisen der Bevölkerung verankert und beliebt.
Die AHV als Teil der schweizerischen Identität wackelt nämlich. Im Sorgenbarometer liegen die Probleme der Alterssicherung an dritter Stelle mit 29% Nennungen. Auf die Probe gestellt wird die Beziehung allerdings nicht nur durch das finanzielle Ungleichgewicht, sondern auch durch einen immer engeren Blick auf die eigenen Vorteile. So zeigt das Sorgenbarometer, dass in der Beurteilung der staatlichen Leistungen zwischen Innen- und Aussensicht eine beträchtliche Lücke klafft. 65% der Befragten geben zwar an, selber zu wenig vom Staat zu erhalten, doch sind nur 39% dieser Meinung, wenn es um die anderen geht; für 51% tut der Staat im Allgemeinen zu viel. Die Diskussion um die vermeintliche Heiratsstrafe in der AHV geht in dieselbe Richtung. Die bevorzugte Behandlung der Ehepaare wären der Beitragsphase wird dabei geflissentlich ausgeblendet.
Die Solidarität zwischen den Einkommensgruppen in den AHV ist riesig. Viele Erwerbstätige zahlen ein Vielfaches dessen ein, was sie später an Rente beziehen. Bei einem Einkommen von 500‘000 Franken werden der AHV, inklusive Arbeitgeberbeiträge, circa 42‘000 Franken pro Jahr geschuldet. Drei Viertel davon – also eine ganze maximale AHV Jahresrente – reine Steuern, die keinerlei Einfluss auf die Rentenhöhe haben. Dass die Grossverdiener bis heute der AHV die Stange halten, ist nicht selbstverständlich. Dies könnte sich ändern, wenn von denen, die ohnehin schon sehr viel beitragen, noch mehr einfordert wird. Schon heute haben internationale Konzerne Mühe, ihren ausländischen Spitzenkräften zu erklären, weshalb sie auch auf dem nicht rentenbildenden Einkommen AHV Beiträge zu entrichten haben. Immerhin: Die Umverteilungsvorlagen 2013 brachten diese auch international aussergewöhnlich starke Solidarität wieder stärker ins Bewusstsein: Die Angst vor wegbrechenden AHV Einnahmen beunruhigt die Stimmbürger mehr – und ist demzufolge eher zu vermitteln – als negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Wie sagte doch der verstorbene Bundesrat Tschudi: „Die Reichen brauchen die AHV nicht, aber die AHV braucht die Reichen.“
Trotz aller – auch selbstgeäusserter – Kritik bleibt die AHV auch für die schreibende Wissenschaftlerin ein integraler Teil des schweizerischen Erfolgsmodells. Nicht nur weil mir die Dankbarkeit meiner Grossmutter für immer im Gedächtnis eingraviert ist.