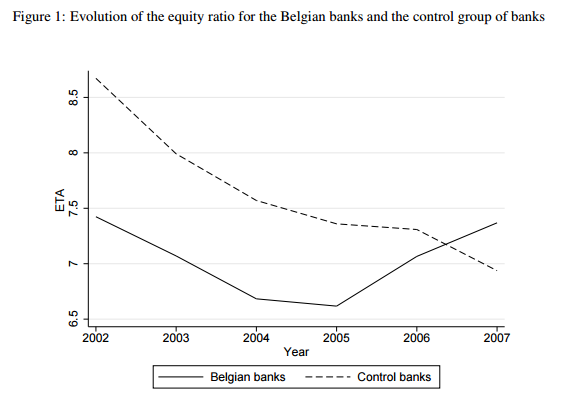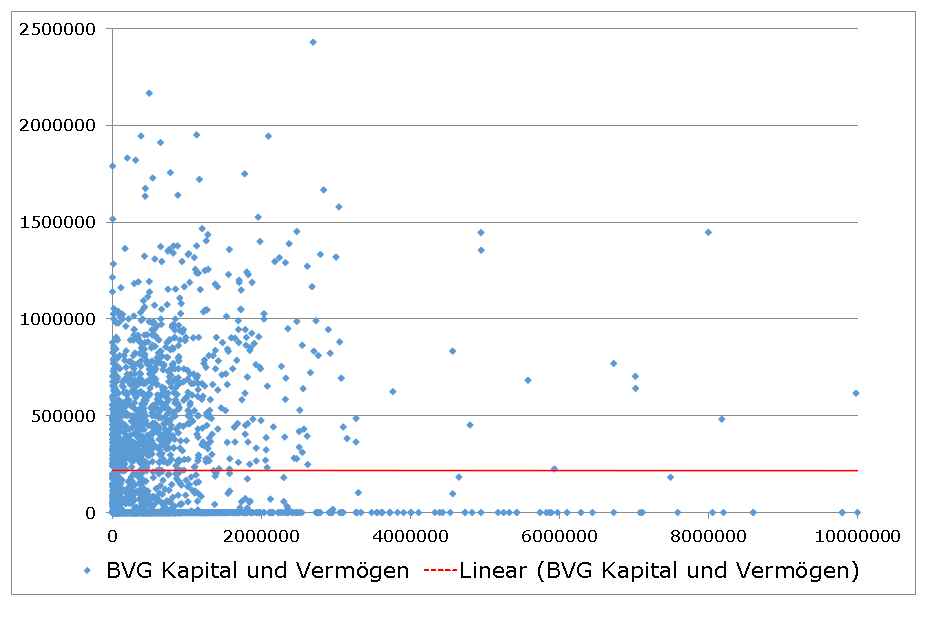Monika Bütler
(publiziert in der NZZ vom 21. Januar 2015)
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB warnte kürzlich vor einer Schuldenbremse in der AHV. Genauer gesagt: vor dem in der Reform Altersvorsorge 2020 als Ventil vorgesehenen zweistufigen Interventionsmechanismus. Dieser klinkt ein, falls der Stand des AHV-Ausgleichsfonds unter 70 Prozent der jährlichen AHV-Ausgaben sinkt. Schafft es der Bundesrat in einer ersten Stufe nicht, geeignete Anpassungen zu treffen, treten in einer zweiten Stufe vordefinierte Massnahmen automatisch in Kraft: eine Erhöhung der AHV-Lohnbeiträge und eine Einschränkung der an Löhnen und Preisen indexierten Rentenerhöhung.
Die Angst des SGB ist verständlich. Immerhin führte die Abkoppelung der Renten von der Entwicklung der Preise und Löhne in Grossbritannien zu einer erheblichen Altersarmut. Überraschender ist die Popularität des Interventionsmechanismus bei den bürgerlichen Parteien. Denn ausreichend wirksam in der relativ kurzen Frist weniger Jahre, in der eine Schuldenbremse greifen muss, sind nur Steuer- oder Beitragserhöhungen. Einsparungen aufgrund eines höheren Rentenalters kämen viel zu langsam; sofortige Rentenkürzungen wiederum sind nicht nur politisch unrealistisch, sondern verstossen gegen Treu und Glauben der Rentner.
Die Schuldenbremse in der AHV ist wohl wegen des Erfolgs der Schuldenbremse bei der Staatsverschuldung so populär. Doch der Interventionsmechanismus einer klassischen Schuldenbremse lässt sich nicht übertragen auf die Altersvorsorge. In der AHV ist es kaum möglich, Kosten zu reduzieren oder Investitionen auf bessere Zeiten zu verschieben. Im Gegensatz zur normalen Schuldenbremse geht es heute bei der Alterssicherung nicht in erster Linie um den mittelfristigen Ausgleich über einen Konjunkturzyklus, sondern um die Korrektur eines langfristigen demographischen Trends, der die Verschuldung nur in eine Richtung zieht: nach oben.
Interessant: In der Reform Altersvorsorge 2020 selber sind weder eine Aussetzung der Indexierung der Renten an Löhne und Preise, noch höhere Lohnbeiträge zentrale Bestandteile. Mit guten Gründen. In einer Rezession, in der eine automatische Schuldenbremse aus offensichtlichen Gründen wahrscheinlicher greift als während einer Hochkonjunktur, schaden die Massnahmen mehr, als sie nützen. Das Lohnwachstum ist ohnehin gering, und eine höhere direkte Belastung der Löhne verstärkt eine Wirtschaftskrise noch.
Das Grundproblem einer Schuldenbremse in der Altersvorsorge liegt allerdings noch tiefer. Der Interventionsmechanismus ist eine verteilungspolitisch fragwürdige und volkswirtschaftlich teure Antwort auf das Fehlen von Automatismen. Bei aller Uneinigkeit über deren Gewichtung und Ausmass: Die in der Reform 2020 vorgesehenen Massnahmen sind volkswirtschaftlich vertretbar: Eine (allerdings homöopathische) Erhöhung des Rentenalters, die Anpassung des Umwandlungssatzes und eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer. Nicht sinnvoll ist hingegen die Fixierung auf feste Zahlen und Zeitpunkte. Denn die Dauer des Rentenbezugs und die finanzierbare Höhe der Rente aus der kapitalgedeckten Vorsorge werden letztlich nicht durch die Politik bestimmt, sondern durch demographische Variablen, wie Lebenserwartung und Bevölkerungsentwicklung einerseits, und wirtschaftliche Grössen, wie Zinsniveau und technischer Fortschritt andererseits. Fixe Anpassungen können in beide Richtungen falsch sein; so ist ein Umwandlungssatz von 6% heute zu hoch, aber zu tief, wenn Inflation und Zinsen wieder einmal auf vergangene Niveaus ansteigen.
Wie alle Fahrzeuglenker wissen: Der richtige Bremszeitpunkt ist, wenn das Hindernis auf der Strasse bemerkt wird. Bei der Alterssicherung der Schweiz ist der richtige Zeitpunkt heute, 2015. Die künftigen Rentner bis 2080 sind nämlich alle bereits geboren. Die oft angeprangerten falschen AHV-Prognosen in der Vergangenheit waren im wesentlichen Fehler im Timing und nicht im Eintreffen der Probleme. Bundesrat Berset hat dies richtig erkannt. Versäumt hat er in der ersten Version seiner Reform, Automatismen einzubauen, welche die nicht politisch bestimmbaren Parameter an deren Bestimmungsfaktoren knüpfen: Eine Anpassung der flexiblen Spanne des Rentenalters an die Lebenserwartung, des Umwandlungssatzes an Zinsumfeld und demographische Parameter.
Es ist durchaus verständlich, dass solche reinen Automatismen Bürgern und Politikern nicht geheuer sind. So sind beim Umwandlungssatz Schwankungen (während einer Finanzkrise beispielsweise) nicht auszuschliessen, die einzelne Rentnergenerationen benachteiligen. Eine vernünftige Alternative zum blinden Autopiloten wäre deshalb ein gesteuerter Automatismus: eine Delegation an eine Kommission, die anhand des Kompass beobachtbarer Variablen eine notwendige Anpassung über die Zeit glätten kann (wie es beispielsweise bei der Mindestverzinsung faktisch bereits der Fall ist).
Wünschenswert wäre zudem, wenn die Eckpfeiler der Rentenreform periodisch, aber zeitlich zwingend vorbestimmt, überprüft werden müssten. So könnten das Feilschen um den richtigen Zeitpunkt und das Aufschieben des politischen Dialogs, wie wir dies in der AHV in den letzten 20 Jahren beobachten mussten, vermieden werden.
Vernünftige Automatismen verstetigen die notwendigen Reformen und verbessern so die Planbarkeit für künftige Rentner. Dauernde Bremsbereitschaft erlaubt eine sanfte Anpassung; diese ist gerechter und effizienter als eine von einer akuten Finanzierungskrise diktierte Vollbremsung im dümmsten Zeitpunkt. Die Reform der Altersvorsorge braucht keine Schuldenbremse. Sie muss selber eine Schuldenbremse sein.