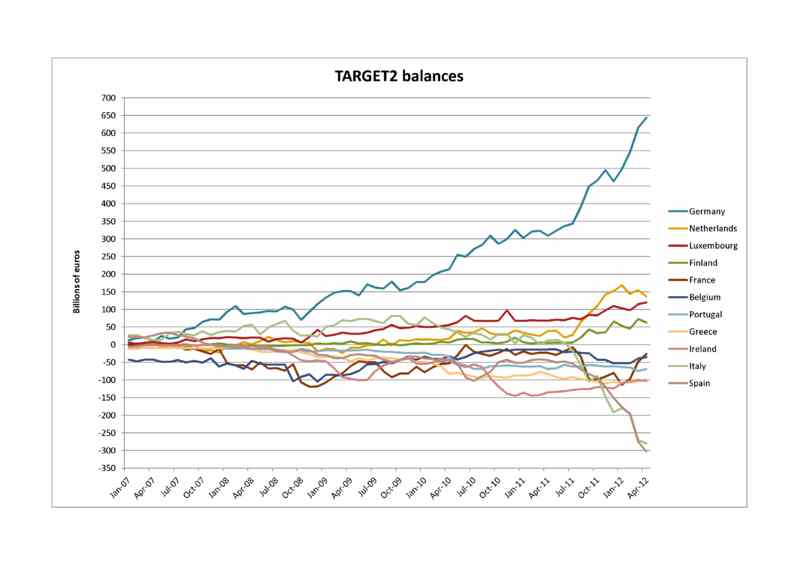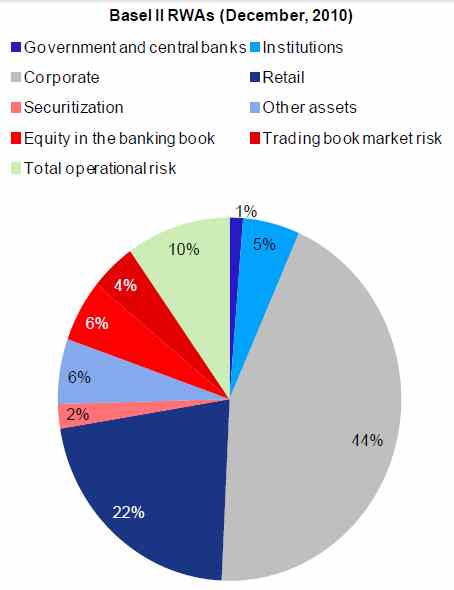Urs Birchler
Letzten Mittwoch sollte ich in 10v10 über den Libor sprechen. Ich entschloss mich, den Libor der Anschaulichkeit halber als Mass für den Pegelstand der Geldversorgung zu umschreiben. Kurz vor der Sendung wurde ich ausgeladen: Der Pegelstand der Aare hatte ein kritisches Mass erreicht …
Wie kann man den (über Jahre von den Banken manipulierten) Libor ersetzen? Diese Frage wird mir in diesen Tagen häufig gestellt (zum Beispiel von, hat-tip, Olivia Kühni). Die Antwort ist nicht ganz einfach. Den Pegelstand am Geldmarkt zu messen ist zwar im Vergleich zum Pegelstand von Flüssen ein Kinderspiel (siehe BAFU und Wikipedia.) Gleichwohl ist der Libor nicht so einfach zu ersetzen.
Als Voll-Ersatz bräuchte es einen Referenzsatz, der ebenfalls für ein Dutzend Währungen und ebensoviele Laufzeiten existiert.
Ein idealer Satz müsste verschiedenen Kriterien genügen:
- Robustheit gegenüber Manipulationen (von Marktteilnehmern, aber auch von Behörden),
- genügende Markttiefe,
- tiefe Volatilität (im Sinne von Zufallsschwankungen),
- Freiheit von Risikoprämien für Kreditrisiken (nur „beste“ Banken wie beim Libor; Pfandsicherung wie beim Saron),
- Beobachtbarkeit von Zinsen und Volumina (bei Libor nur teilweise erfüllt),
- Transparenz der Berechnungsmethode.
Naheliegende Alternative für den Bereich Schweizer Franken wären die Swiss Reference Rates der SNB. Diese beruhen auf Transaktionen an der SIX. SIX offeriert ein gutes Factsheet.
Der liquideste Markt ist jener für Ein-Tages-Geld (SARON; -ON steht für overnight); Tagesgeldsätze sind aber sehr volatil und eignen sich nur bedingt als Referenzsätze z.B. für Hypotheken. Direkter Konkurrent des Libor wäre der 3-Monats-Satz (SAR3M) (auf dessen Libor-Schwester die Geldpolitik der SNB und die Libor-Hypotheken der Banken basieren). Dieser schneidet nach den obengenannten Kriterien unterschiedlich ab:
- Dank Pfandsicherung sind die Sätze frei von Risikoprämien.
- Die täglichen Volumina liegen zwischen null und CHF 14 Mrd (Durchschnitt seit Juni 1999: 1.4 Mrd.).
- An manchen Tagen existiert kein Kurs (z.B. vom 28.6 bis 5.7.2012).
- Die Tagesschwankungen der Preise sind beträchtlich.
- seit April 2012 sind die Sätze oft negativ.
- Die Berechnungsmethode ist transparent.
- Die Robustheit von Tageswerten gegenüber strategischen Transaktionen von Banken scheint fraglich. Wenn bei einer Bank ein hohes SAR3M-Derivatvolumen fällig wird, kann sich bei dünnem Markt ein Verlustgeschäft im Grundkontrakt lohnen.
- Sollte die SNB beim Ziel ihrer Geldpolitik vom Libor zum SAR3M wechseln (in der Nach-1.20-Ära), würden geldpolitische Entscheide 1:1 zu direkten Umverteilungen zwischen den Privatparteien, die SAR3M-basierte Verträge abgeschlossen haben. Hier liegt geldpolitisches Konfliktpotential.
Auch im Ausland dürfte keiner der in der Realität vorhandenen Sätze alle Kriterien erfüllen. Die Suche nach einem Libor-Nachfolger dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Einstweilen werden Vertragsparteien gut überlegen, auf welchen Satz sie abstellen wollen. Im Darwinistischen Wettbewerb wird es vielleicht irgendwann einen Sieger geben. Dies kann auch der (geläuterte) Libor sein; als Grundlage zahlloser Geschäfte wird er ohnehin noch auf weiteres existieren.