Die Tagepresse meldet, Heizpilze dürften künftig nur noch mit Ökostrom betrieben werden. Dies sieht aus wie der salomonische Kompromiss zwischen den Extremlösungen Verbot oder Laissez Faire, bzw. Laisser Chauffer. Ist es aber gerade nicht. Die Zuordnung von zulässigen Energiequellen zu einzelnen Verbrauchsgeräten führt direkt in die Hölle. Heizpilz mit Ökostrom, Operationssaal auch mit Atomstrom, das Opernhaus je nach Standpunkt mit Kerzen, mit Mischstrom oder gar nicht. Obwohl ich mir nichts sehnlicher wünsche als den pedalgetriebenen Laubbläser: Solche Lösungen züchten eine Erlass- und Kontrollbürokratie, die uns direkt in den kafkaesken Wahnsinn führt. Nimmt mich wunder, wer all den Heizpilzen nachgehen wird, um zu schauen, was sie grad für Strom gefressen haben.
Wollen wir wirklich enden wie Gulliver im Lande Liliput — gefesselt von einer Unzahl dünner Fäden, die einzeln leicht zu zerreissen wären, aber gemeinsam unüberwindlich sind?
Wenn wir uns nicht kollektiv zu Sklaven machen wollen, bleibt nur der Preismechanismus. Wenn CO2 (oder Energie) einen Preis hat — auch wenn dieser wesentlich höher sein sollte als heute –, kann immerhin jeder selber entscheiden, wieviel er ausgeben will und wofür. Des einen Heizpilz mag dann des anderen Candlelight Dinner sein. Ökostrom-für-böse-Geräte-Vorschriften hingegen sind die Henkersmahlzeit. Und ja, der Preismechanismus ist blind; auf den „Bedarf“ nimmt er keine Rücksicht. Zuschriften wegen Neoliberal werde ich deshalb sorgfältig lesen. Im Dunkeln.

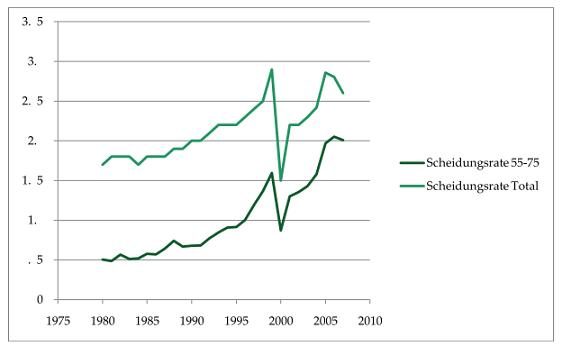
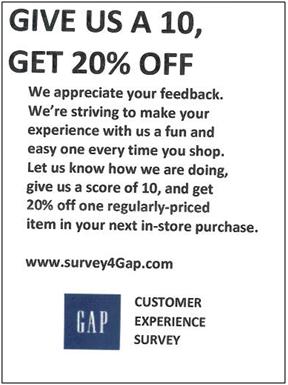 Wer kennt sie nicht, die Umfragen zur Konsumentenzufriedenheit. Sei es nach einem Flug, einer Hotelübernachtung oder nach einem Einkauf im Kleiderladen. Alle wollen „ehrliches“ Feedback zur Dienstleistungsqualität. Aber nicht nur dies. Die Umfrageergebnisse werden auch mannigfaltig eingesetzt. Einerseits in der Werbung, „90 Prozent zufriedene Kunden…“, andererseits auch intern, indem die Kundenzufriedenheit in die Bewertung von Niederlassungen oder Mitarbeitern einfliesst.
Wer kennt sie nicht, die Umfragen zur Konsumentenzufriedenheit. Sei es nach einem Flug, einer Hotelübernachtung oder nach einem Einkauf im Kleiderladen. Alle wollen „ehrliches“ Feedback zur Dienstleistungsqualität. Aber nicht nur dies. Die Umfrageergebnisse werden auch mannigfaltig eingesetzt. Einerseits in der Werbung, „90 Prozent zufriedene Kunden…“, andererseits auch intern, indem die Kundenzufriedenheit in die Bewertung von Niederlassungen oder Mitarbeitern einfliesst.