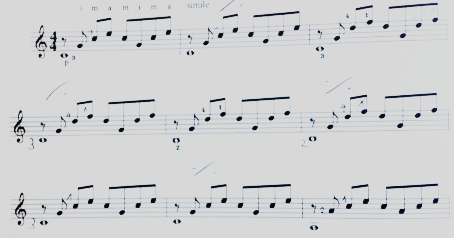Urs Birchler

Hochverehrte Regierung der Stadt Zürich, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, geschätzte Miteinwohner!
Ein Hafenkran-Graben spaltet unsere Stadt. Seit der Reformation standen sich kaum je zwei derart unversöhnliche Lager gegenüber. Der Gemeinderat hat nun, wie die Presse meldet, für weitere 258’000 (von insgesamt notwendigen 600’000) Franken Oel ins Feuer gegossen.
Deshalb erlauben wir uns einen letzten Kompromissvorschlag!
Batz.ch hat einen Kran gefunden, der höchsten Zürcher Ansprüchen genügen würde. Es handelt sich um die Hikitia. Sie hat eine eigne Homepage und ist in der Wikipedia aufgeführt. In drei Jahren feiert sie ihren Neunzigsten und — sie braucht Geld.
Die Bildredaktion von Batz.ch hat sich den Kran vor Ort in Wellington, Neuseeland, angesehen (siehe Bild) und ist beeindruckt. Die Hikitia ist kein gewöhnlicher Kran, sondern ein Dampfkran und der letzte ihres Typs. Hikitia kommt von Maori für „to lift up“, auch im übertragenen Sinn von „nach Höherem streben“ (ka hikitia ist denn auch der Name eines Schulprogramms). Was gäbe es daher Passenderes für Zürich als die historische Begeisterung der Zürcher für Hafenkrane, Aufwärtsstreben (und Schulprogramme) in Form eines Beitrags von 600’000 Franken an die weiter Renovation der Hikitia zu bezeugen?
Der grösste Nachteil der Hikitia ist gleichzeitig ihr Vorteil: Sie käme nie bis zum Limmatquai. Dafür könnte sie (sie kam einst aus Schottland) für die Übergabe der Schenkungs-Urkunde zum exakten Gegenpunkt Zürichs auf der Weltkugel dampfen: Der Punkt (Koordinaten: 47,37 S; 171,46 W) liegt vor den neuseeländischen Chatham-Inseln. Das ist nicht irgendwo, sondern dort, wo das neue Millenium zum ersten Mal auf Festland traf! Die Chathams haben zahlreiche vorgelagerte kleine Inseln. Vielleicht würde sich der östlichste Fels — Neuseeländer sind ein dankbares Volk — in „Lady Mauch“-Rock umtaufen lassen oder wenigstens ein Blätz pazifischer Freihaltezone in „Uetli-Reserve“, womit die Sonne künftig in Zürich aufginge.
Die Übergabe der Schenkungsurkunde würde dann am Limmatquai live auf Grossleinwand übertragen, und die (um die Touristenattraktion geprellten) Gaststätten entlang des Limmatquai servieren als moderne Form der Milchsuppe Hikita-Eis.