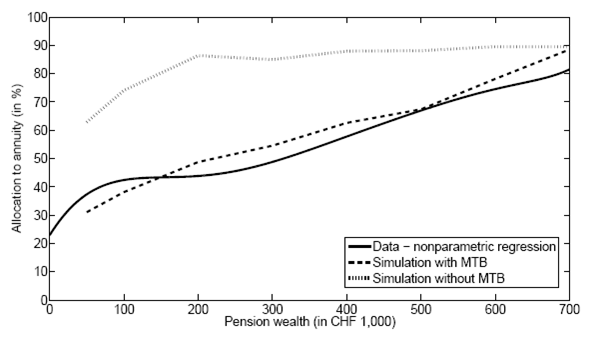Monika Bütler
Als erste Gemeinde der Schweiz führte die Stadt Luzern 2009 Betreuungsgutscheine für die ausserfamiliären Kinderbetreuung ein (man spricht manchmal auch von einem Wechsel von der Objektfinanzierung zur Subjektfinanzierung der Krippenplätze). Mit dem neuen Finanzierungsmodell in Luzern werden staatliche Subventionen nicht mehr an die Betreuungseinrichtungen bezahlt (welche damit Plätze zu reduzierten Tarifen anbieten), sondern direkt an die Eltern. Eltern mit geringen oder mittleren Einkommen müssen somit nicht erst einen subventionierten Platz suchen, sondern können sich mit dem Gutschein in der Hand die Betreuungseinrichtung selber aussuchen.
Aus ökonomischer Sicht ist dieser Wechsel sinnvoll: Erstens wird die Anzahl der verbilligten Kinderbetreuungsplätze nicht mehr – wie heute in fast allen Städten – rationiert. Zweitens erhalten die Eltern Wahlfreiheit in der Betreuungseinrichtung. Diese Wahlfreiheit ermöglicht nicht nur einen Wettbewerb zwischen den Krippen, sondern erlaubt es den Eltern, die für sie passendere Lösung zu finden. Und nicht, wie bei der heute üblichen Objektfinanzierung, entweder keinen Platz zu erhalten oder durch die halbe Stadt reisen zu müssen.
Mit Betreuungsgutscheinen wird zudem Rechtsgleichheit geschaffen: Jeder Haushalt, der die notwendigen Kriterien zum Erhalt von Subventionen erfüllt, erhält diese auch. Lange Wartelisten werden vermieden und es gilt nicht „De gschneller isch de gschwinder“. Dies ist umso wichtiger, weil bisherige Studien vermuten lassen, dass die Rationierung der subventionierten Plätze auf Kosten der weniger gut ausgebildeten Eltern geht. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass Akademikereltern Krippenplätze beanspruchen rund dreimal höher als dies bei den übrigen Familien der Fall ist. Die Betreuungsgutscheine sind zudem an eine Erwerbstätigkeit geknüpft.
Nach der Einführung der Betreuungsgutscheine zeigte sich schnell: Auch in der Stadt Luzern überstieg die Nachfrage nach subventionierter Kinderbetreuung das Angebot bei weitem. Nach 2009 stieg die Anzahl betreuter Plätze steil an und stabilisierte schliesslich im Jahr 2013. Dies ohne Abstriche an der Betreuungsqualität dank Investitionen in die Qualität der Kinderbetreuung.
Kinderbetreuung ist ein kostspieliger Faktor in der Schweiz. Die Kosten dürften ein Grund sein, dass Mütter dem Erwerbsleben fern bleiben oder nur mit geringem Pensum beschäftigt sind (siehe hier meine alte, aber noch immer gültige Analyse). Meine Doktorandin Alma Ramsden untersuchte im Rahmen ihrer Dissertation, welchen Einfluss das neue, universelle Kinderbetreuungssystem in der Stadt Luzern (sowie in den Gemeinden Emmen und Kriens) auf die finanzielle Sicherheit die Erwerbstätigkeit von Paaren mit Kindern und Alleinerziehenden hat.
Almas Analyse zeigt, dass die Verfügbarkeit von Betreuungsgutscheinen die Einkommen der betroffenen Familien positiv und signifikant erhöhten – sowohl für Paarhaushalte mit Kindern wie auch für Alleinerziehende. Da Alleinerziehende einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind, ist vor allem letzterer Befund von sozialpolitischer Relevanz: Betreuungsgutscheine helfen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Alleinerziehenden zu stärken. Weil eine Erhöhung der Einkommen immer auch mit grösseren Steuereinnahmen verbunden ist, ist davon auszugehen, dass die Betreuungsgutscheine die Ausgaben der Gemeinden (zumindest teilweise) wieder kompensieren. Die Resultate zeigen auch, dass Eltern mit Betreuungsgutscheinen nicht einfach von informeller zu formeller Kinderbetreuung wechselten. Betreuungsgutscheine erhöhten auch die Arbeitstätigkeit von Alleinerziehenden und ZweitverdienerInnen deutlich. Die positiven Effekte finden sich nicht nur in der städtischen Gemeinde Luzern, sondern auch in den kleineren, vorstädtischen Gemeinden Emmen und Kriens.
Almas Forschung ist in den heutigen Diskussionen zur Aktivierung der Frauen in der Wirtschaft besonders wertvoll. Sie zeigt auf, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur davon abhängt, wie viel die Kinderbetreuung den Familien kostet (die Kosten veränderten sich nämlich in Luzern nicht), sondern vor allem auch davon, ob die Familien überhaupt Zugang zu subventionierten Plätzen haben. Den Blogleser(innen) sei hier die Lektüre des Berichts empfohlen.
PS: Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Steuerbehörden der Stadt Luzern und den Gemeinden Emmen und Kriens, sowie bei der Abteilung Kind Jugend Familie der Stadt Luzern für die Bereitstellung der Daten und wertvolle Unterstützung.