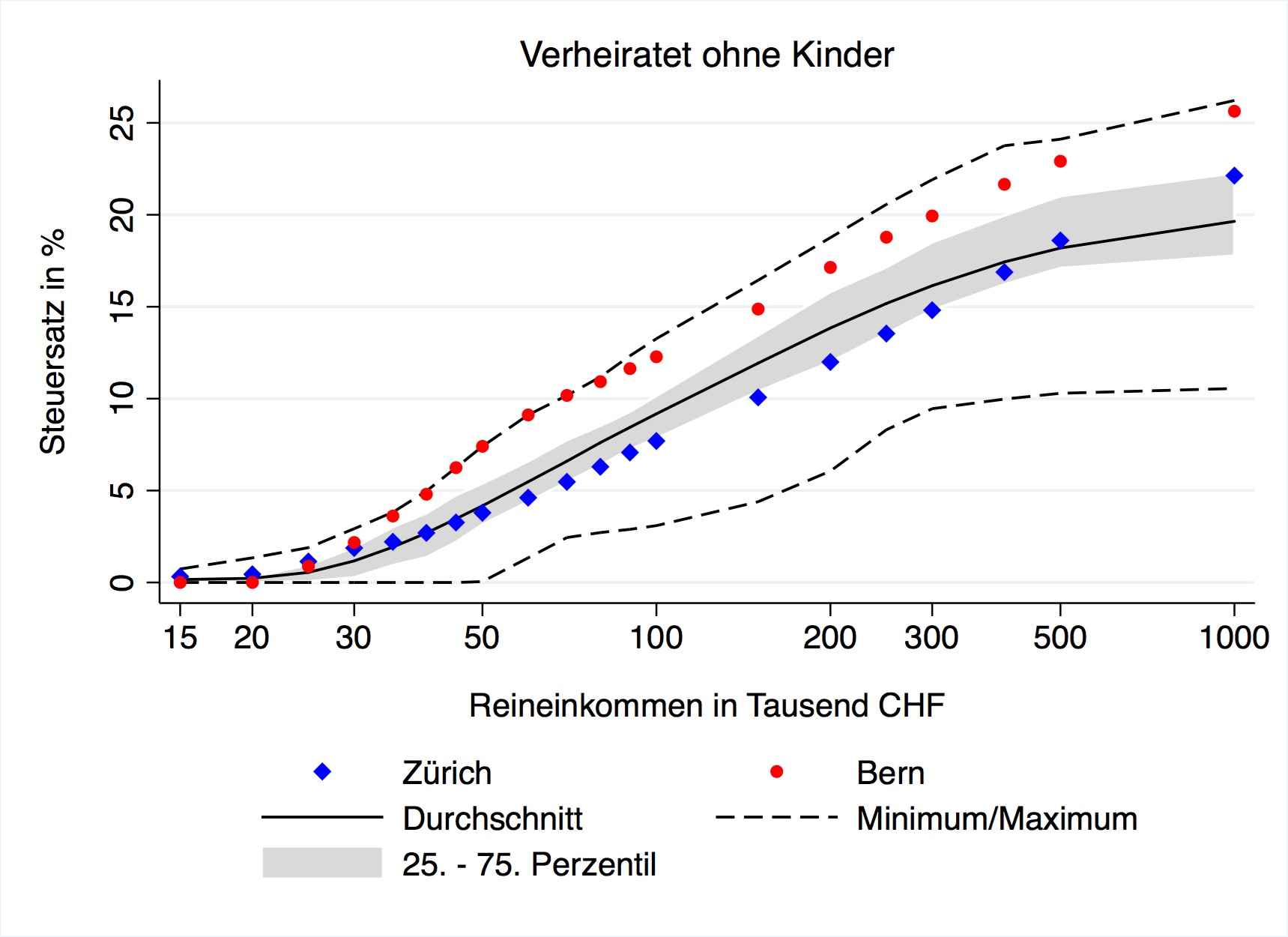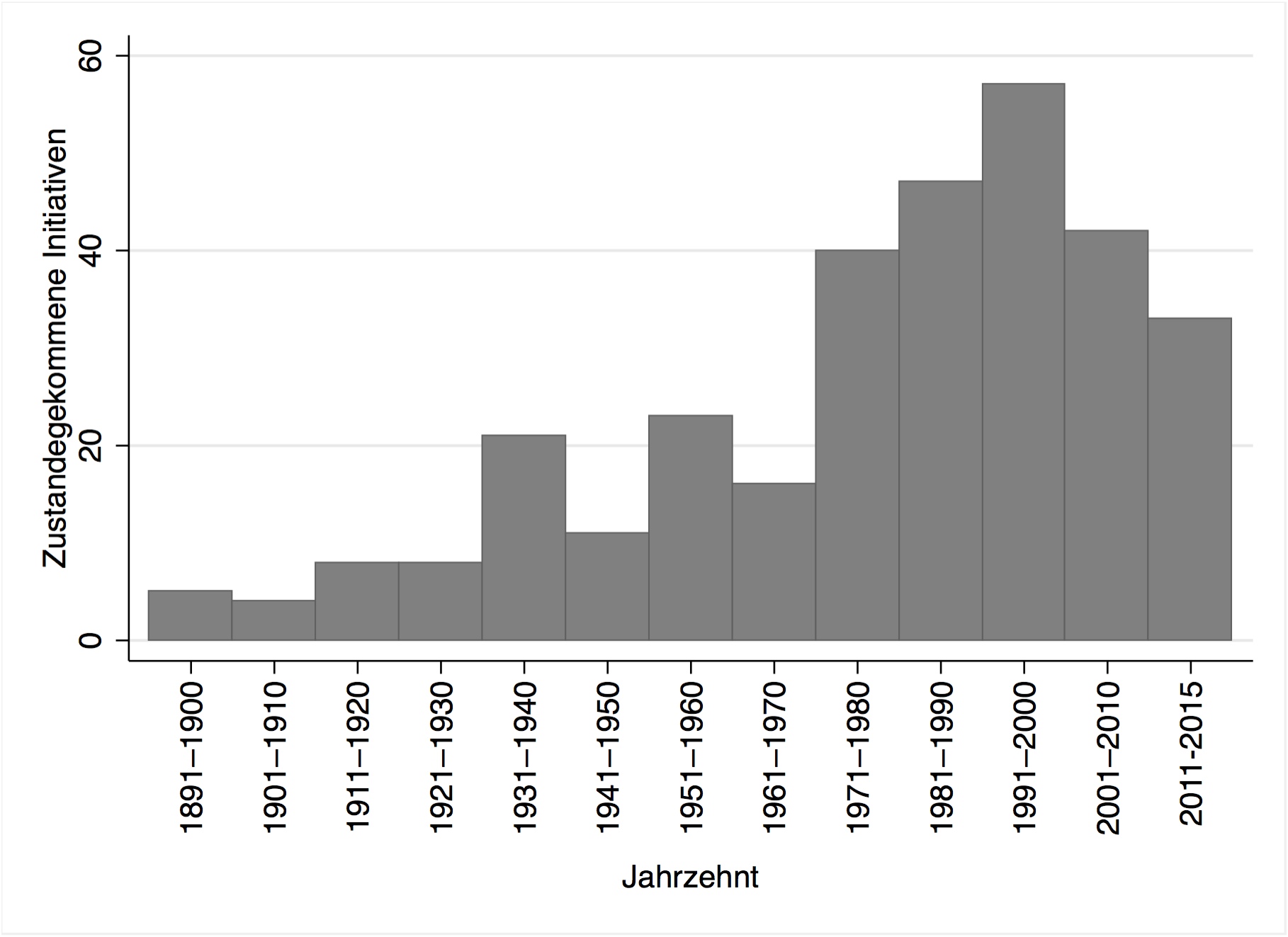Monika Bütler
Wenn die SVP mich schon in ihrem Positionspapier zur Sozialhilfe zitiert, dann doch bitte mit vollständigen Quellenangaben:
Das 1. Zitat stammt aus einem Interview mit der Annabelle, das hat sich die SVP offenbar nicht getraut zu erwähnen.
Das 2. Zitat stammt aus der Schweizer Ausgabe der Zeit. Thema der Ausgabe „Wie kann man die SVP stoppen? Meine Antwort: Sozialhilfe renovieren. Der ganze Text ist unten angefügt.
Das 3. Zitat stammt – wie angegeben – aus einem Interview mit dem Tagesanzeiger. Die Aussage bezog sich lediglich auf die jungen Sozialhilfebezüger.
Das 4. Zitat stammt aus dem gleichen Text wie das 2. (siehe Text unten)
Vielen Dank an Marie Baumann für den Hinweis. Damit sich die Leser(innen) selber ein Bild meiner Position machen können, hier der ganze Text aus der Zeitausgabe des 9. Oktober 2014:
Sozialhilfe renovieren: Die falschen Anreize müssen weg.
Die SVP bläst zum Angriff auf die Sozialhilfe. Mit dem üblichen Slogan „x Franken sind genug“ und ihrem sicherem Gespür für den richtigen Zeitpunkt: Die Sozialhilfeausgaben steigen, viele Erwerbstätige leben mit weniger Geld als Sozialhilfebezüger, die Sozialindustrie nervt.
Die SVP ist nicht die erste Partei, die sich des Themas annimmt. Auch die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen will die Sozialhilfe ersetzen. Und liberale Kreise liebäugeln damit, die Existenzsicherung ins Steuersystem zu integrieren, was Schwelleneffekte beim Übergang ins Erwerbsleben vermeiden soll.
Bei so viel Skepsis von allen Seiten: Ist das Instrument überholt? Nein, Sozialhilfe ist gut, weil sie aus drei Gründen das verfassungsmäßige Recht auf Existenzsicherung kostengünstig und zielgerichtet erreicht. Im Prinzip.
Erstens ist nur für eine Minderheit der Sozialhilfebezüger das fehlende Einkommen das größte Problem. Viel eher leiden sie an Suchtverhalten, zerrütteten Familienverhältnissen und fehlender Integration. Nur eine eingehende Prüfung und entsprechende Maßnahmen führen hier zum Ziel.
Zweitens liefern die Sozialhilfebehörden das viel bessere Maß der Bedürftigkeit als das steuerbare Einkommen. Eine Ablösung der Sozialhilfe durch eine Integration ins Steuersystem würde zu viel höheren Kosten führen. Viele, die gemäß Steuererklärung arm scheinen, sind es gar nicht und können keine Sozialhilfe beantragen.
Drittens erhöht diese genaue Prüfung die Akzeptanz der Sozialhilfe. Nicht nur, wer die Leistung bezahlt, muss seine Einkünfte auf den letzten Rappen dokumentieren, sondern auch der Empfänger. Opfersymmetrie, sozusagen.
Die explodierenden Kosten sind damit noch nicht erklärt. Die Ausgesteuerten sind es kaum, sie sind zu wenige. Schwindende Hemmungen, Sozialhilfe zu beantragen? Eine aufgeblähte Sozialhilfeindustrie? Ohne Daten bleibt das Spekulation. Fest steht: Im Vergleich zu den stagnierenden Arbeitseinkommen von niedrig qualifizierten Menschen ist die Sozialhilfe eher attraktiver geworden. Denn die gestiegenen Wohn- und Gesundheitskosten werden separat entschädigt, während die durch den Grundbedarf abgedeckten Güter wie Lebensmittel billiger geworden sind.
Was tun? Der von der SVP vorgeschlagene Wettbewerb zwischen den Gemeinden differenziert am falschen Ort. Wir brauchen, erstens, eine stärkere Abstufung aller Leistungen nach Art der Bezüger: Was für den arbeitsscheuen 22-Jährigen passt, ist für die 60-jährige Ausgesteuerte mit gesundheitlichen Problemen zu wenig Geld und zu viel Druck. Zweitens müsste das Dickicht der Zusatzzahlungen ausgeholzt werden. Kinderreiche Familien kommen mit Sozialhilfebeiträgen teilweise auf ein höheres Einkommen als viele Ein- und Doppelverdiener-Haushalte; nicht gerade ein Ansporn für die Kinder, sich später selber helfen zu wollen. Heute könnte auch der Mutter eine Erwerbstätigkeit zugemutet werden. Es ist schließlich nicht Aufgabe der Sozialhilfe, familiäre Machtverhältnisse mit schweizerischem Komfort zu finanzieren. Und obwohl die Sozialhilfe bereits das soziale Existenzminimum deckt, werden zusätzlich Integrationszulagen bis zu 300 Franken im Monat bezahlt, wenn jemand etwa aktiv nach einer Stelle sucht.
Man kann sich also fragen: Stünden Integrationszulagen nicht eher Geringverdienern und älteren Ausgesteuerten zu, die nach 40 Jahren Arbeit durch die Maschen fallen? Und was nützt ein Einkommensfreibetrag von 600 Franken, der den Anreiz erhöht, ein wenig zu arbeiten, aber wirksam den Ausstieg aus der Sozialhilfe verhindert, weil dieser mit einem erheblichen Einkommensverlust einhergehen würde? Und: Handelt der Staat klug, wenn er gleichzeitig niedrig qualifizierte Arbeiten wie auch die Integration der Niedrigqualifizierten auslagert? „Insourcing“ würde vielleicht keine Kosten senken, aber den Behörden eine enge Betreuung der Sozialhilfeempfänger ermöglichen.
Wird der SVP-Angriff auf die Sozialhilfe also gelingen? Nein. Wieso? Weil nationalkonservative Haltungen mittlerweile in weiten Kreisen salonfähig sind. Und welcher aufrechte Eidgenosse würde einen älteren ausgesteuerten Schweizer darben lassen, wenn er vorher noch ein paar Millionen bei den faulen Flüchtlingen sparen kann?